in möblierten Zimmern.
Mißstände im Erlanger Hauswesen. Aufenthalt im Palmsgarten. Der
Krieg vom Jahre 66. Waffenstillstand 154
10. Kapitel 1866-1869. Winterpläne. Stuttgart. Cannes. Deutsche
Häuslichkeit. Religiöser Einfluß. Erfolglosigkeit der Kur. Entschluß zur
Abreise. Bozen. Ausflug nach Meran. Rückkehr nach München.
Französisches Examen. Die Kinder in Erlangen. Kammerauflösung.
Telegraphische Berufung. Tod Karl Braters 176
Dritter Teil: =Die Witwe=
11. Kapitel 1869-1870. Aufzeichnungen über die letzten Lebenstage. In
tiefer Trauer. Briefe von Braters Freunden. Teilnahme an den
politischen Erlebnissen. Entschluß zu dem Bruder zu ziehen. Religiöse
Zweifel. Einfluß Nagels. Adreßdebatte 197
12. Kapitel 1870-1875. Gemeinsamer Haushalt in Erlangen.
Schwierigkeiten mit den Kindern. Der Krieg vom Jahre 70. Jahrestag
von Braters Tod. Gedicht von Leuthold. Eine Braut im Hause. Wie das
Paar zusammenkam. Friedensschluß. Hochzeit. Geselliges Talent. Tod
des Bruders Hans. Vormundschaft. Großmutterfreuden. Schwager und
Schwägerin Sartorius. 211
13. Kapitel 1875-1883. Die zweite Braut. Schwere Trennung.
Briefwechsel zwischen Mutter und Tochter. Besuche in Blaubeuren.
Drei Enkelsöhne. Kerlers Versetzung. Kampf gegen materialistische
Weltanschauung. Übersiedelung nach Würzburg. Das Schicksal des
ältesten Pflegsohnes 238
14. Kapitel 1883-1886. Aufregende Fragen. Abschied von Julie.
Nachrichten aus Amerika. Frau Brater im Ruhestand. Interesse für
Afrika. Kontrolle der Sonnenbahn. Pfarrer Blumhardt in Boll. Nagels
Buch. Briefe von Schultheß 258
15. Kapitel 1886-1896. Tod des Bruders Fritz. Alte Freundschaften.
Frau Braters hervorragende Eigenschaften im Verkehr. Ihr Einfluß. Der
kleine Haushalt. Wärmeverwertung. Reisen in die Schweiz und nach
Tirol. Augenleiden. Über Dienstmädchen. Eine neue Nichte. Sorge um
der Enkelin Leben. Kerlers silberne Hochzeit 275
16. Kapitel 1896-1907. Letzter Brief von Ernst Rohmer.
Lungenentzündung. Tod des Schwiegersohnes Sapper. Übersiedelung
der Familie nach Würzburg. Gemeinsame Haushaltung mit der Tochter.
Entbehren der häuslichen Tätigkeit. Schriften von #Dr.# Johannes
Müller. Letzte Briefe an Lina Sartorius. Gedanken über Erlösung aus
hoffnungslosem Leiden. Urgroßmutter. Letzter Besuch des
Schwiegersohnes. Sein Scheiden. Trauer. Ein leichter Heimgang 295
Erster Teil
=Mädchenjahre=
I.
1827-1835
Ein Familienereignis ersten Ranges war es nicht, als am 27. August
1827 dem Professor der Mathematik in Erlangen Wilhelm Pfaff von
seiner Ehefrau Luise, verwitwete Kraz, ein Töchterlein geboren wurde.
Waren doch schon Kinder in stattlicher Zahl vorhanden! Gab es doch
schon:
Aurora, Heinrich, Luise, Siegfried, Hans, Colomann, Friedrich;
vielleicht wären die Eltern auch mit diesen sieben zufrieden gewesen,
die Leben und Bewegung genug in das Haus brachten, während nicht
übergenug vorhanden war von dem, was zur Erhaltung solchen Lebens
nötig ist. Da nun dies kleine Wesen von niemandem begehrt war, so
mag es wohl von der ersten Stunde seines Erscheinens an die Richtung
mit bekommen haben, die es Zeit seines Lebens einhielt: sich nicht für
etwas Hervorragendes zu halten und es als ein unverdientes Glück zu
empfinden, wenn ihm im Laufe des Lebens einmal mehr als das Nötige
zuteil wurde.
Ob ersehnt oder nicht, das achte Kind lag in der Wiege und die Familie
nahm freundlich Stellung zu ihm. Man mußte freilich eng
zusammenrücken, damit der Platz reichte in der beschränkten Wohnung.
Vielleicht war es eben in dieser Zeit, da der Vater, der nicht nur als
Professor der Mathematik und Astronomie wirkte, sondern auch eifrig
das Studium des Sanskrit betrieb, eine originelle Einrichtung traf, um
trotz der lärmenden Kinderschar an seinem Schreibtisch ungestört
arbeiten zu können. Ein eigenes Studierzimmer konnte er sich bei den
beschränkten Geldverhältnissen nicht gönnen. So zog er denn in dem
großen gemeinsamen Zimmer einen festen Kreidestrich um seinen
Arbeitstisch und diese Ecke durfte keines der Kinder betreten. Mochten
sie im übrigen Teil des Zimmers herumtoben wie sie wollten, das störte
den Gelehrten nicht in seiner Arbeit und er ließ sie gutmütig gewähren.
Betrat aber einer der Jungen unbedacht des Vaters Reservat, so war ein
derber Schlag die sichere Folge dieses Übertritts in das verbotene
Gebiet.
Als sein achtes Kind zur Welt kam, war Professor Pfaff mit dem
Dichter und damaligen Professor Friedrich Rückert an einer
gemeinsamen Arbeit, an der Übertragung der indischen Dichtung Nal
und Damajanti ins Deutsche. Da nun Rückert ebenso sparsam wie Pfaff
war -- hatte sich doch einer der beiden Professoren von dem andern das
Sanskritlexikon abgeschrieben, um es nicht kaufen zu müssen -- so
behalfen sich auch die beiden Gelehrten mit einem Exemplar dieser
Dichtung und täglich wanderte das Buch über die Straße hinüber und
herüber. Den Kindern der beiden Häuser, die die Boten machen mußten,
waren Nal und Damajanti vertraute Namen, lange bevor sie dem
deutschen Volk bekannt wurden. Weil nun Pfaffs Jüngste auf die Welt
kam, während ihres Vaters Gedanken auf Damajanti gerichtet waren, so
erhielt das Kind den Namen Damajanti, den der Pfarrer nicht ohne
Bedenken in das Kirchenbuch eintrug, doch wurde ihr zum täglichen
Gebrauch neben diesem poetischen noch der gut bürgerliche Name
Pauline beigelegt.
Die sieben Geschwister, in deren Kreis die kleine Pauline eintrat, waren
aus drei Ehen zusammengekommen, denn sowohl Pfaff als seine Frau
Luise geb. Plank waren vor dieser Ehe schon verheiratet gewesen.
Sie beide stammten aus Württemberg, hatten sich dort schon als
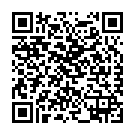
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



