zierliches und farbenreiches musivisches Schmucksystem aus,
welches mit Anlehnung an antike Vorbilder aus dem unerschöpflichen
Vorrat an römischen Baustücken in wertvollen Steinen aller Art sein
Material herbeiholt und gerade durch die Fülle und den Wert desselben
zur Ausbildung dieser Dekorationsweise angeregt wurde; als
Cosmatenarbeit benannt, weil namentlich der Marmorarius Cosmas und
seine Familie dieselbe ausübte. Ein Beispiel dafür, doch schon aus
späterer Zeit, bietet die Aschenurne (No. 31).
[Abbildung: 28A. Marmorbüste aus Rom.]
Zwischen diesen Arbeiten steht das Bruchstück eines großen
plastischen Werkes, welches in Rom ausgegraben wurde und das sich
jetzt im Berliner Museum befindet, bisher vereinzelt und unerklärt da:
der kolossale Marmorkopf eines bärtigen Mannes, den der Reif im
lockigen Haar wohl als Fürsten charakterisiert (No. 28A). Neben den
oben genannten, etwa gleichzeitigen süditalienischen Büsten fällt in
diesem Marmorwerke der enge Anschluß an antike Büsten archaischen
Stils, sowie die außerordentlich saubere Ausführung und teilweise
schon individuelle Empfindung auf, wie sie sich z. B. in der
Behandlung des Ohres bekundet. Die eigentümlich stilisierte
Behandlung des flach anliegenden lockigen Barthaares findet sich ganz
übereinstimmend im Haar der Bronzewölfin im Kapitol, die auch sonst
in ihrer Auffassung und Behandlung mehr mittelalterlichen als antiken
Charakter hat. Wir werden daher auch dieses Werk der römischen
Plastik des XIII. Jahrh. zuzuschreiben haben, die uns in ihrer
Entwickelung und im Zusammenhang mit der Plastik des übrigen
Italien noch manches zu raten giebt.
Eine klare und stetige Entwickelung und eine reichere Entfaltung zeigt
die Skulptur nur in Norditalien und Toskana. Von vornherein, seit dem
Anfang des XII. Jahrh., tritt sie hier in gesunder Verbindung mit der
Architektur zur Hebung und Belebung ihrer Glieder auf; auch geht sie
denselben Weg, den sich hier die selbständige Entwickelung der
Architektur bahnt: vom Mittelpunkt des alten Longobardenreiches, von
Mailand und seiner Umgebung, wird sie durch Marmorarbeiter dieser
Orte (namentlich aus Como) nach Mittelitalien übertragen und lange
Zeit vorwiegend durch diese »Comasken« ausgeübt. Die Lombardei
selbst hat nur dürftige Reste aufzuweisen; die großen Reliefs am
Tabernakel über dem Hochaltar in S. Ambrogio zu Mailand sind in
ihrer starren Regelmäßigkeit, wenn nicht von byzantinischer Herkunft,
doch erst aus dem XIII. Jahrh.; das beweisen die rohen Skulpturen der
Porta Romana vom Meister Anselmus, die aus den Jahren 1167 bis
1171 datieren. Sehr bedeutend sind dagegen die Überreste, welche
heute noch in Verona erhalten sind: das Portal des Domes (1135) und
namentlich die Fassade von S. Zeno sind hier mit reichstem
Skulpturenschmuck verziert. Beide Arbeiten gehen wenigstens
teilweise auf Meister Nicolaus zurück, der an S. Zeno mit dem Meister
Wilhelm zusammen arbeitet, dann am Dom von Modena thätig ist und
1139 auch das Portal des Domes zu Ferrara mit reichem plastischen
Schmuck versieht. Neben diesen Steinarbeiten bieten die aus vielen
ehernen Platten bestehenden Thürflügel von San Zeno das Bild einer
äußersten Barbarei in allen körperlichen Bildungen dar. Die einzelnen
Tafeln könnten auch verschiedenen Ursprungs und Alters sein. Mit
einigen älteren deutschen Bronzearbeiten haben sie gemein, daß die
Figürchen in ihrem starken Hochrelief wie aufgenietet erscheinen.
Teppichartig bedecken die Marmorreliefs die Wände und zeigen eine
kindlich naive, unbeholfene und derbe, ja selbst rohe, aber eigenartige
Erzählungs- und Darstellungsweise. Das Relief springt hier durchweg
kräftig über den Rahmen hinaus, der ganz flach bleibt; doch sind die
Figuren, selbst die Extremitäten dabei gleichmäßig in der Fläche
gehalten. Die viel lebendigeren und besser verstandenen Figuren an
dem Taufbecken in S. Giovanni in Fonte zu Verona gehören schon
einer vorgeschritteneren Zeit an und verraten, wie die gleichzeitigen
venezianischen Bildwerke, die Schulung durch byzantinische Künstler
und Vorbilder.
Den Arbeiten in Verona und Ferrara sind die noch umfangreicheren
Skulpturen in Parma und dem benachbarten San Donino schon
wesentlich überlegen. An beiden Orten ist Benedetto Antelami, der sich
in bezeichneten Arbeiten zwischen den Jahren 1178 und 1196
nachweisen läßt, der maßgebende Künstler. Hier wie an den
vorgenannten Orten sind die Portale Mittelpunkt des Reliefschmuckes,
welcher das Bogenfeld, den Bogen, Sturz und Pfosten, vielfach auch
die Wandflächen zu den Seiten und den Baldachin vor der Thür
bedeckt, und dessen Motive Scenen aus dem alten und neuen
Testament, namentlich aus der Schöpfungsgeschichte und der Passion,
dann Folgen genreartiger Darstellungen der Monate, sowie (an den
Einrahmungen, als Säulenträger u. s. f.) phantastische Tierbilder und
gelegentlich Darstellungen lokaler Beziehung zeigen. Im Innern ist der
plastische Schmuck weit spärlicher; die Kapitelle der Säulen, Kanzeln,
Lettner, Taufbecken, Weihwasserbecken und einzelne Architekturteile
sind mit Reliefs geschmückt, die sich aber leider meist nicht mehr an
ihrem Platze befinden. Die Arbeiten Antelami's zeichnen sich vor den
älteren lombardischen Bildwerken aus durch glückliche
architektonische Verteilung, klare Anordnung, saubere und
gleichmäßige Ausführung, durch ausgebildete Reliefbehandlung,
bessere Naturbeobachtung und namentlich durch feinere innere
Beziehungen ihres Ideengehaltes. Dies gilt in höherem Maße noch von
einigen jetzt aus ihrem Zusammenhange gerissenen Skulpturen im
Innern des Baptisteriums, die schon dem XIII. Jahrh. angehören.
Ungeschickter und flüchtiger in der Arbeit, aber durch den reineren
Reliefstil, der die Figuren schon fast frei
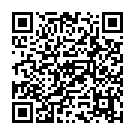
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



