übergrosser Fülle? Und welche Bedeutung hat dann, physiologisch
gefragt, jener Wahnsinn, aus dem die tragische wie die komische Kunst
erwuchs, der dionysische Wahnsinn? Wie? Ist Wahnsinn vielleicht
nicht nothwendig das Symptom der Entartung, des Niedergangs, der
überspäten Cultur? Giebt es vielleicht - eine Frage für Irrenärzte -
Neurosen der Gesundheit? der Volks-Jugend und -Jugendlichkeit?
Worauf weist jene Synthesis von Gott und Bock im Satyr? Aus
welchem Selbsterlebniss, auf welchen Drang hin musste sich der
Grieche den dionysischen Schwärmer und Urmenschen als Satyr
denken? Und was den Ursprung des tragischen Chors betrifft: gab es in
jenen Jahrhunderten, wo der griechische Leib blühte, die griechische
Seele von Leben überschäumte, vielleicht endemische Entzückungen?
Visionen und Hallucinationen, welche sich ganzen Gemeinden, ganzen
Cultversammlungen mittheilten? Wie? wenn die Griechen, gerade im
Reichthum ihrer Jugend, den Willen zum Tragischen hatten und
Pessimisten waren? wenn es gerade der Wahnsinn war, um ein Wort
Plato's zu gebrauchen, der die grössten Segnungen über Hellas gebracht
hat? Und wenn, andererseits und umgekehrt, die Griechen gerade in
den Zeiten ihrer Auflösung und Schwäche, immer optimistischer,
oberflächlicher, schauspielerischer, auch nach Logik und Logisirung
der Welt brünstiger, also zugleich "heiterer" und "wissenschaftlicher"
wurden? Wie? könnte vielleicht, allen "modernen Ideen" und
Vorurtheilen des demokratischen Geschmacks zum Trotz, der Sieg des
Optimismus, die vorherrschend gewordene Vernünftigkeit, der
praktische und theoretische Utilitarismus, gleich der Demokratie selbst,
mit der er gleichzeitig ist, - ein Symptom der absinkenden Kraft, des
nahenden Alters, der physiologischen Ermüdung sein? Und gerade
nicht - der Pessimismus? War Epikur ein Optimist - gerade als
Leidender? - - Man sieht, es ist ein ganzes Bündel schwerer Fragen, mit
dem sich dieses Buch belastet hat, - fügen wir seine schwerste Frage
noch hinzu! Was bedeutet, unter der Optik des Lebens gesehn, - die
Moral? . . .
5.
Bereits im Vorwort an Richard Wagner wird die Kunst - und nicht die
Moral - als die eigentlich metaphysische Thätigkeit des Menschen
hingestellt; im Buche selbst kehrt der anzügliche Satz mehrfach wieder,
dass nur als ästhetisches Phänomen das Dasein der Welt gerechtfertigt
ist. In der That, das ganze Buch kennt nur einen Künstler-Sinn und -
Hintersinn hinter allem Geschehen, - einen "Gott", wenn man will, aber
gewiss nur einen gänzlich unbedenklichen und unmoralischen
Künstler-Gott, der im Bauen wie im Zerstören, im Guten wie im
Schlimmen, seiner gleichen Lust und Selbstherrlichkeit inne werden
will, der sich, Welten schaffend, von der Noth der Fülle und Ueberfülle,
vom Leiden der in ihm gedrängten Gegensätze löst. Die Welt, in jedem
Augenblicke die erreichte Erlösung Gottes, als die ewig wechselnde,
ewig neue Vision des Leidendsten, Gegensätzlichsten,
Widerspruchreichsten, der nur im Scheine sich zu erlösen weiss: diese
ganze Artisten-Metaphysik mag man willkürlich, müssig, phantastisch
nennen -, das Wesentliche daran ist, dass sie bereits einen Geist verräth,
der sich einmal auf jede Gefahr hin gegen die moralische Ausdeutung
und Bedeutsamkeit des Daseins zur Wehre setzen wird. Hier kündigt
sich, vielleicht zum ersten Male, ein Pessimismus "jenseits von Gut und
Böse" an, hier kommt jene "Perversität der Gesinnung" zu Wort und
Formel, gegen welche Schopenhauer nicht müde geworden ist, im
Voraus seine zornigsten Flüche und Donnerkeile zu schleudern, - eine
Philosophie, welche es wagt, die Moral selbst in die Welt der
Erscheinung zu setzen, herabzusetzen und nicht nur unter die
"Erscheinungen" (im Sinne des idealistischen terminus technicus),
sondern unter die "Täuschungen", als Schein, Wahn, Irrthum,
Ausdeutung, Zurechtmachung, Kunst. Vielleicht lässt sich die Tiefe
dieses widermoralischen Hanges am besten aus dem behutsamen und
feindseligen Schweigen ermessen, mit dem in dem ganzen Buche das
Christenthum behandelt ist, - das Christenthum als die
ausschweifendste Durchfigurirung des moralischen Thema's, welche
die Menschheit bisher anzuhören bekommen hat. In Wahrheit, es giebt
zu der rein ästhetischen Weltauslegung und Welt-Rechtfertigung, wie
sie in diesem Buche gelehrt wird, keinen grösseren Gegensatz als die
christliche Lehre, welche nur moralisch ist und sein will und mit ihren
absoluten Maassen, zum Beispiel schon mit ihrer Wahrhaftigkeit
Gottes, die Kunst, jede Kunst in's Reich der Lüge verweist, - das heisst
verneint, verdammt, verurtheilt. Hinter einer derartigen Denk- und
Werthungsweise, welche kunstfeindlich sein muss, so lange sie
irgendwie ächt ist, empfand ich von jeher auch das Lebensfeindliche,
den ingrimmigen rachsüchtigen Widerwillen gegen das Leben selbst:
denn alles Leben ruht auf Schein, Kunst, Täuschung, Optik,
Nothwendigkeit des Perspektivischen und des Irrthums. Christenthum
war von Anfang an, wesentlich und gründlich, Ekel und Ueberdruss des
Lebens am Leben, welcher sich unter dem Glauben an ein "anderes"
oder "besseres" Leben nur verkleidete, nur versteckte, nur aufputzte.
Der Hass auf die "Welt", der Fluch auf die Affekte, die Furcht vor der
Schönheit und Sinnlichkeit, ein Jenseits, erfunden, um das Diesseits
besser zu verleumden, im Grunde ein Verlangen in's Nichts, an's Ende,
in's Ausruhen, hin zum "Sabbat der Sabbate" - dies Alles dünkte mich,
ebenso wie der unbedingte Wille des Christenthums, nur moralische
Werthe gelten zu lassen, immer wie die gefährlichste und
unheimlichste Form aller möglichen Formen
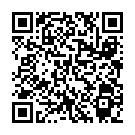
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



