ihr zu behaupten, daß sie
das Nichtsein den Leiden des Daseins vorziehe, da ja bei ihr vielmehr
das ganze Leiden in der bitteren Notwendigkeit des Sterbens
besteht?--Wo finden wir die Resignation selbst bei einem MACBETH
oder RICHARD III.?
Freilich, daß solche Ausnahmen sich finden, daß nicht in allen
Tragödien der Held zur Resignation gelange, dies wird ausdrücklich
zugestanden. Die Resignation, sagt man uns, bleibe eben in solchen
Fällen der Reflexion des Zuschauers überlassen. Aber damit ist doch
wohl zugleich ausdrücklich zugestanden, daß die tröstliche Aussicht, in
welcher der eigentliche Sinn der Tragödie bestehen sollte, ganz
außerhalb des Kunstwerkes steht, und lediglich dem Zuschauer zur Last
fällt, der den Dichter ergänzt oder korrigiert, wie es ihm eben beliebt.
Giebt die thatsächliche Resignation des Helden uns das Bewußtsein,
daß wir unter gleichen Umständen derselben Resignation fähig sein
würden, dann muß ebenso sicher der Mangel der Resignation, der ja
auch im Kunstwerk wohl motiviert ist, die Überzeugung in uns wecken,
daß wir unter gleichen Umständen ebenso unresigniert sein würden.
Gewinnen wir trotzdem auch im letzteren Falle die Zuversicht unserer
eigenen Resignationsfähigkeit, so gelangen wir dazu auf unsere eigenen
Kosten und dem Kunstwerk zum Trotz. Wir können dann ebensowohl
aus jeder beliebigen Komödie die gleiche Zuversicht schöpfen. Das
Kunstwerk ist schließlich gänzlich gleichgiltig geworden.
"Reflexionen" können wir ja jederzeit anstellen, welche wir wollen.
Fassen wir alles zusammen, so leuchtet ein, worin für die Theorie in
Wahrheit der Genuß des tragischen Kunstwerkes besteht. Man geht ins
Theater, um sich seiner glücklich gewonnenen Weltanschauung zu
freuen. Stimmt damit das aufgeführte Stück überein oder läßt es sich so
umdeuten, daß es damit übereinzustimmen scheint, dann freut man sich
auch an dieser wirklichen oder vermeintlichen Übereinstimmung. Will
das Stück sich durchaus nicht der Weltanschauung fügen, nun, dann
läßt man das Kunstwerk Kunstwerk sein und begnügt sich mit der
Freude an seiner eigenen Weisheit.
Das tragische Kunstwerk ist eben, so wenig wie irgendwelches
Kunstwerk, dazu da Weltanschauungen zu predigen oder zu bestätigen,
pessimistische so wenig wie optimistische. "Aber der Dichter muß doch
irgend eine Weltanschauung haben, und die muß in seinem Werke zu
Tage treten. Und nur der wird das Kunstwerk recht verstehen, der sich
auf den Boden dieser Weltanschauung stellt."--Ich frage: Warum dies
alles? Mag der Dichter als Mensch, sozusagen für seinen
Privatgebrauch eine Weltanschauung haben. Als Dichter bedarf er
keiner solchen, es sei denn, daß es ihm darauf ankommt in seinen
Gestalten einen Kampf der Weltanschauungen zur Darstellung zu
bringen. Im übrigen wird er sogar gut thun, seine Weltanschauung
möglichst für sich zu behalten. Was er in jedem Falle braucht, ist
Kenntnis der Welt und des in ihr Möglichen; Verständnis für das, was
in der Welt ist und auf das menschliche Gemüt zu wirken vermag;
Beherrschung der Sprache, in der die Erscheinungen in der Welt ihren
Sinn und Inhalt zu offenbaren pflegen. Will man dies Weltanschauung
nennen, so ist es doch nicht Weltanschauung in dem hier
vorausgesetzten philosophischen Sinne des Wortes.
So haben denn auch große Dichter keine oder eine sehr schwankende
"Weltanschauung" gehabt, und hatten sie eine, so hüteten sie sich das
Kunstwerk zur Darlegung und Anpreisung dieser Weltanschauung zu
mißbrauchen.
Nur in einem Sinne, außer dem eben zugestandenen, muß der Dichter
und jeder Künstler als solcher Weltanschauung haben und geben, wenn
nämlich unter "Welt" die Welt des Kunstwerkes verstanden wird. Diese
Welt ist seine Welt und diese Welt allerdings muß ihm, indem er sie
schafft, Gegenstand einer klaren, einheitlichen und von innerer
Wahrheit erfüllten Anschauung sein. Eben diese "Weltanschauung" soll
dann gewiß auch der Betrachter gewinnen.
DIE "POETISCHE GERECHTIGKEIT".
Ich sagte schon, daß das tragische Kunstwerk, wie keine pessimistische,
so auch keine optimistische Weltanschauung predige. Es hat mit beiden
gleich viel oder gleich wenig zu thun. Es giebt aber eine Theorie der
Tragödie, die optimistisch genannt werden kann, auch wohl sich selbst
so nennt und die das tragische Kunstwerk, wenngleich in anderer Weise,
darum doch nicht minder verfälscht als die besprochene pessimistische.
Die gemeinte Theorie fordert, daß das Übel, das dem Helden widerfährt,
insbesondere sein schließlicher Untergang, als "Strafe" des Bösen, als
"Sühne" für eine "Verschuldung" erscheine. Sie kennt eine überall in
der Tragödie waltende "poetische Gerechtigkeit". Daß es eine solche
Gerechtigkeit in der Welt gebe, daß alle Schuld sich auf Erden räche,
dies soll der erhebende Gedanke sein, den das Trauerspiel
vergegenwärtige und in dessen Vergegenwärtigung sein eigentlicher
Sinn bestehe.
Wir fragen zunächst: Besteht denn, wirklich jene Gerechtigkeit in der
Welt, rächt sich wirklich alle Schuld auf Erden? Soviel wir wissen,
nicht. Schuldige und Unschuldige gehen unter: Unschuldige und
Schuldige bleiben erhalten und freuen sich ihres Daseins. Die Besten
empfinden mit tiefem, vielleicht vernichtendem Schmerze, was die
Bösen, die Oberflächlichen, die sittlich Stumpfen gleichgiltig oder mit
lächelndem Achselzucken ansehen. Darnach ist es ein unwahrer
Gedanke, den die Tragödie vergegenwärtigt oder es ist unwahr, daß ihn
die Tragödie vergegenwärtigt.
Die Tragödie vergegenwärtigt den Gedanken nicht. Die Tragödie
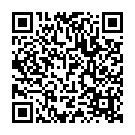
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



