die
Beziehungen, in die es im Kunstwerke verflochten erscheint.
Dagegen hebt jede Einmischung eines Gedankens, der sich auf das
bezieht, was außerhalb des Kunstwerkes liegt, jede Herzubringung
eines Interesses außer dem Interesse am Kunstwerk selbst und seinem
Inhalte das eigentliche Wesen des Kunstwerkes auf. Die Vermengung
ist nicht klüger als die von Traum und Wirklichkeit, der Versuch vor
allem, "trostreiche" Gedanken für die Wirklichkeit aus dem
Kunstwerke zu ziehen, nicht geistreicher als der Versuch, das Kapital,
das man im Traume gewonnen, im wachen Leben auf Zinsen zu legen.
Doch weiter. Aus gewissen Bedingungen folgt jedesmal in der
Tragödie das Preisgeben des Daseins seitens des Helden. Er wendet
sich vom Leben--wenn er es thut--nicht auf Grund einer
philosophischen Reflexion über die Vortrefflichkeit der Nichtexistenz,
sondern weil ein großes Leid, ein unlösbarer Konflikt über ihn
hereingebrochen ist. Warum dies?
Man sagt uns, der Held müsse durch die Unlösbarkeit des Konfliktes
erst dazu gebracht werden, die Welt zu überwinden, die instinktive
Todesfurcht abzuschütteln, das Nichtsein begehrenswert zu finden. Wie
ihm das Leiden, so solle uns der Anblick des Leidens die
Vortrefflichkeit des Nichtseins im Vergleich zu den Leiden des Daseins
zum Bewußtsein bringen. Auch sei die Preisgabe des Lebens für den
Helden erst auf Grund der Unlösbarkeit des Konfliktes verzeihlich.
Denn von Hause aus habe der Einzelne die Pflicht sich dem Leben und
seinen Aufgaben zu erhalten, obgleich diese Aufgaben zuletzt auf
nichts anderes hinauslaufen, als darauf, auch die übrige Welt zur
Abkehr vom Leben reif zu machen.
Aber ist damit nicht die ganze "tröstliche Aussicht" wiederum
illusorisch gemacht? Angenommen der Held entschlösse sich zur
Preisgabe des Daseins ohne besondere Veranlassung, etwa unter
Recitation einiger "Lichtstrahlen" aus pessimistischen Werken. Dann
könnten wir vielleicht aus seinem Verhalten die tröstliche Zuversicht
gewinnen, daß auch uns, denen einstweilen die besondere Veranlassung
fehlt, ein gleiches Verhalten möglich sei. Wie aber, wenn das Gegenteil
dieser Annahme stattfindet?
Daß die Veranlassung zur Preisgabe des Daseins beim Helden der
Tragödie eine besondere, daß die Bedingungen seines Unterganges
außerordentliche zu sein pflegen, das tut ja doch wohl keine Frage.
Man hat sogar diese Besonderheit oder Außerordentlichkeit über
Gebühr gesteigert. Der tragische Konflikt, sagte man, setze jederzeit
eine "Überhebung" seitens des Helden voraus. Dies bezweifle ich. Ich
wüßte wenigstens nicht, worin die Überhebung einer EMILIA
GALOTTI bestehen sollte. Aber lassen wir diesen Punkt hier noch
unentschieden. Uns genügt, daß unter Voraussetzung gewisser, nicht
alltäglicher Bedingungen, und nur unter Voraussetzung derselben, der
tragische Held sich vom Leben abzuwenden pflegt.
Diese Bedingungen müssen gewiß, so wenig alltäglich immer,
mögliche und naturgemäße, sie müssen "normale" Bedingungen sein.
Ob sie dagegen irgend einmal wirklich waren, oder größere oder
geringere Aussicht haben, wirklich zu werden, hat wiederum mit dem
Kunstwerke nichts zu thun. Angenommen aber, wir können es nun
einmal nicht lassen, in die Phantasiewelt des Kunstwerkes die wirkliche
Welt hineinzumengen, insbesondere Nutzanwendungen auf uns selbst
zu machen. Dann ist zum mindesten gefordert, daß die Nutzanwendung
dem entspreche, woraus sie gezogen ist. Nun liegt im Gedanken, daß
wir können, was der Held kann, ein Vergleich des Helden mit uns.
Dieser Vergleich hat, wie bei Vergleichen üblich, auch seine Kehrseite.
Der unlösbare Konflikt besteht jetzt für uns nicht. Wir müssen auch die
Möglichkeit, bzw. die größere oder geringere Wahrscheinlichkeit
zugeben, daß die Bedingungen, die ihn notwendig herbeiführen, für uns
nicht eintreten werden. Natürlich muß dieser Gedanke unsere
"tröstliche Zuversicht" stören. Die Möglichkeit oder
Wahrscheinlichkeit, daß wir nie in eine Lage kommen werden, in der
die Abwendung vom Leben auch für uns unvermeidlich und darum
verzeihlich wäre, die uns zugleich von der "instinktiven Todesfurcht"
befreite, so daß wir das Nichtsein dem Dasein auch praktisch vorziehen
könnten, diese Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit muß uns sogar mit
umso größerem Schmerz und Neid erfüllen, je tröstlicher jene
"tröstliche Aussicht" für uns sein würde.
Daran ändert auch die Behauptung nichts, daß in jedem Menschen
Konflikte "ruhen", die ihrer Natur nach unversöhnlich sind, und daß es
nur der Zufälligkeit der Verhältnisse zu danken sei, wenn sie nicht zum
Ausbruch kommen. Denn die ruhenden, nicht aufgebrochenen
Konflikte, das sind eben doch Konflikte, die thatsächlich nicht bestehen.
Vielleicht brechen sie einmal aus. Aber die Unsicherheit, ob sie
ausbrechen werden, ob wir also Aussicht haben, es dem Helden einmal
nachmachen zu können oder nicht, das Hangen und Bangen zwischen
dieser Aussicht und der gänzlichen Aussichtslosigkeit muß uns in einen
Zustand marternder Unruhe versetzen, der erst recht das Gegenteil ist
von der erhebenden Wirkung des tragischen Kunstwerks.
Lassen wir auch diesen Punkt. Wenn wenigstens die Voraussetzung
dieser wunderbaren Theorie zuträfe; wenn wenigstens der Held der
Tragödie wirklich überall resigniert vom Leben sich abkehrte.
Thatsächlich ist ja auch dies nicht der Fall. Oder wo ist in
ANTIGONEs herzzerreißender Klage, daß sie das Leben verlassen
müsse, diese Abkehr? Wo ist die Resignation, das Abschütteln der
Todesfurcht, das Wegwerfen des Daseins als eitel und wertlos? Was
kann es auch nur für einen Sinn haben, von
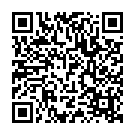
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



