kleinen Randleisten, mit
denen Holbein die Titel schmückte, spielten sogar schon damals die
Tritonen und Nereiden eine Rolle. Es galt die Stadt auch als eine der
fröhlichsten am Rhein, der Frau Venus besonders hold. Aber mit der
Reformation war ein puritanischer Geist eingezogen, der sich bis ins 19.
Jahrhundert erhalten hat, und ein großer Teil der angesehensten alten
Familien geht sogar, wie schon die Namen andeuten, auf Flüchtlinge
zurück, die ihres Glaubens wegen aus Italien, Frankreich und auch aus
Deutschland eingewandert waren. Diese haben nun allerdings fremde
Industrien hierher verpflanzt und damit den Reichtum gefördert und es
wurde dem alemannischen Stamme der Bevölkerung durch sie auch ein
fremdes und gutes Reis aufgepfropft. Aber seit dem 17. Jahrhundert
war der Zustrom von außen nur ein sehr schwacher und das
Gemeinwesen hat sich nicht mehr vergrößert. Die Bevölkerung erhielt
dadurch ein scharf ausgesprochenes Gesicht, wie es in heutigen Städten
gar nicht mehr möglich ist und dies Gesicht sah etwas anders aus als im
Anfange des 16. Jahrhunderts.
Die Stadt war sprichwörtlich für ihren Erwerbssinn und ihren Reichtum,
aber auch für die altväterischen Gepflogenheiten, den Familiensinn, die
Frömmigkeit, den Gemeinsinn und ihre Wohltätigkeit. Kaufmännische
Tugenden gaben neben der pietistisch gefärbten Religiosität der
Physiognomie der Bewohner ihre charakteristischen Züge.
Allein es fehlte durchaus nicht an geistigem Leben, nur kam der
Wohlstand mehr der Wissenschaft als der Kunst, und unter den
Künsten am meisten der Musik und der Baukunst zugute. Durch alle
Zeiten des Stillstandes und des Niederganges hatte sich die Universität
erhalten und so haben neben Böcklin in den sechziger Jahren des 19.
Jahrhunderts auch ein Jakob Burckhardt und ein Nietzsche gewirkt.
Aber auch die Gemälde und Zeichnungen Holbeins, die sich aus den
Tagen des Glanzes im Besitze der Stadt erhalten haben, waren immer
geschätzt, wenn auch vielleicht nicht häufig besichtigt worden und
übten ihre stille Wirkung aus. In der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts begann ferner das Interesse für das Münster und die
übrigen mittelalterlichen Kirchen der Stadt zu erwachen. Namentlich
aber ist schon seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts eine aufsteigende
Entwicklung auf dem Gebiete der Architektur zu beobachten. Diese
brachte später, in der Rokokozeit, die große Zahl von schönen, zum
Teil sogar prunkvollen Patrizierhäusern hervor, die dem Innern der
Stadt noch heute ihr Gepräge verleihen. Nebenher kam auch das
Sammeln von Bildern auf. Der Malerberuf war zu Beginn des 19.
Jahrhunderts in dieser Stadt der Kaufherren und der frommen Sitte an
sich durchaus nicht gerade verachtet, wenn man auch dem Erbauer
komfortabler Familienhäuser jedenfalls mehr Verständnis und sicher
weit größere persönliche Achtung entgegengebracht haben wird, als
den Jüngern der leichter geschürzten Muse der Malerei. Was den
fürsichtigen und bedächtigen Baslern damals wirklich zu einem
Kunstleben fehlte, war vielleicht nur der Sinn für naiven Lebensgenuß
und schönen Schein und jener Leichtsinn, der zu großen Taten
schließlich nun einmal nötig ist. Wenigstens vermißt man in vielen
Äußerungen der damaligen und noch einer späteren Zeit das Gefühl für
das Heroische im Verhalten eines Mannes, der ohne finanzielle
Sicherheiten, nur im Bewußtsein eigener Kraft, eine Bahn betrat, die
den Winden und Wogen ein so sicheres Ziel bot wie der Künstlerberuf,
und der auch noch auf dieser an sich schon gefährlichen Bahn, lediglich
der eigenen Vernunft gehorchend, alles Hergebrachte und Anerkannte
in den Wind schlug.
Die Maler, die in Böcklins Jugend in Basel den Stand vertraten, waren
nicht dazu angetan, diese Anschauungen zu ändern. Sie waren keine
Gesetzgeber sondern Diener des Zeitgeschmackes. Fast alle sind sie
zwar von der deutschen Bewegung, die von Carstens, Koch und den
Nazarenern ausging, berührt worden. In Basel aber kamen sie dem
Bedürfnis nach Alpenlandschaften und Veduten nach und
unterrichteten die Jugend in einer Zeichenschule, die im 18.
Jahrhundert gegründet worden war. Einer von ihnen, der genial
veranlagte Hieronymus Heß, ist in der Enge der Heimat, verbittert und
versauert, als Mensch und Künstler zugrunde gegangen, ein anderer,
Miville, einer der Lehrer Böcklins an der Zeichenschule, hat auf vielen
Reisen in zahlreichen Skizzenbüchern dieselben Gegenden und
ähnliche Motive wie später sein Schüler verewigt, wenn auch ohne alle
tiefere Originalität und ohne den feineren Natursinn des größeren
Nachfahren.
Nicht der Glanz, mit dem Böcklin etwa als Knabe den Maler umgeben
sah, hat ihn auf seine Bahn gelockt, sondern innere Notwendigkeit und
das Gefühl, daß das, was er in sich trug, etwas Stärkeres und Besseres
sei als die Triebkräfte, die seine künstlerische Umgebung beherrschten.
Böcklin ist der Sohn eines Kaufmanns, dessen Großeltern aus
Beggingen im Kanton Schaffhausen eingewandert waren. Der
Urgroßvater des Malers war offenbar ein verarmter Landwirt, der in
einer Basler Fabrik sein Brot suchte und fand, auch der Großvater war
Fabrikarbeiter; mit dem Vater aber begann der Aufstieg. Er war ein
erfinderischer Kopf, hatte sich schon in ganz jungen Jahren durch die
Verbesserung eines roten Farbstoffes die Wertschätzung seines
Brotherrn erworben, dann mit zweiundzwanzig Jahren eine Tochter aus
gebildeter und auch etwas wohlhabender Familie
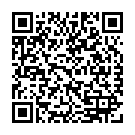
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



