19. Jahrhunderts geboren, in den fünfziger und
sechziger Jahren mit den Traditionen der Corneliusschule gebrochen
und in Deutschland eine neue Kunst heraufgeführt haben, eine
Blütezeit der Malerei, wie sie seit den Tagen Dürers und Holbeins nicht
mehr gewesen war. Er ist ein Altersgenosse von Anselm Feuerbach,
Viktor Müller (auch von Piloty, Knaus und Vautier) und ging Lenbach,
Hans von Marées, Hans Thoma, Toni Stadler, Karl Haider, Gabriel
Max und Makart um ein Jahrzehnt oder wenig mehr voraus. Als er sich
der Malerei zuwandte, hat Cornelius den Karton der apokalyptischen
Reiter geschaffen, begann Rethel die Fresken im Aachener Rathause
und die Holzschnitte des Totentanzes und es folgten die duftigsten
Werke von Schwind, wie das Aschenbrödel und die Wartburgfresken,
und die reifsten Holzschnittfolgen von Ludwig Richter bald nach.
Die führenden Geister aber der in dieser Zeit heranwachsenden
Generation haben im Kolorit ihr kräftigstes Ausdrucksmittel gefunden.
Sie begannen die Koloristen unter den Meistern der früheren
Jahrhunderte zu studieren. Es richtete sich das neue Interesse
hauptsächlich auf die Farbenkomposition, die Kunstmittel, mit denen
die koloristische Gesamthaltung in früheren Zeiten erzielt worden war,
aber auch auf die Malmittel, die technischen Verfahren, die
handwerkliche Praxis, welche die vorausgehende Zeit vernachlässigt
hatte. Böcklin meinte gelegentlich: Wer heute in der Kunst noch etwas
erreichen wolle, müsse die Malerei von neuem erfinden. Die
heranwachsende Generation wandte sich nach Belgien und nach Paris,
hauptsächlich zu Couture, sie lernte von Delacroix und den Meistern
von Barbizon. Die Mehrzahl aber, wenigstens gerade die
Bedeutendsten und Einflußreichsten, haben schließlich nicht in
Frankreich, sondern in Italien im Umgang mit den Werken der alten
Kunst die entscheidende Richtung für ihr ganzes Leben gefunden und
diese im Umgang mit Kollegen und Schülern weitergebildet.
Böcklin ist einer der ältesten, selbständigsten und eigenartigsten unter
diesen Künstlern. Er ist noch mehr als alle übrigen seine eigenen Wege
gegangen, am meisten verschrieen und verhöhnt worden, war während
der größten Zeit seines Wirkens wie Feuerbach, Thoma, Hans von
Marées, nur von wenigen erkannt, abseits gestanden und hat schließlich
die größte Fülle von Beifall geerntet.
Er gehört zur deutschen Kunst, so gut wie die anderen, obwohl er in
Basel geboren und aufgewachsen ist und auch von schweizerischen
Eltern stammt, obwohl auch für seine Kunst ein Aufenthalt in Paris von
einiger Bedeutung, und der erste siebenjährige in Italien entscheidend
war. Der einzige Lehrer und der einzige Studiengenosse, der auf seine
Richtung von tieferem Einfluß war, waren Deutsche ihrer Kunst und
Herkunft nach, ebenso die Mehrzahl der Freunde und Kollegen, die er
in den entscheidenden Jahren um sich sah. Er ist, was gewöhnlich
übersehen wird, aus der heroischen Landschaftsmalerei
herausgewachsen, die seit Asmus Carstens und Jos. Anton Koch in
Deutschland gepflegt wurde und immer Verständnis gefunden hat. Er
ist der Sohn und Erbe dieser ganzen Richtung. Er hat auch fast nur in
deutschen Landen zuerst Verständnis und später allgemeinen Beifall
gefunden, und die Erfolge, die er in Deutschland errungen hat, haben
sein Ansehen in seiner Vaterstadt erst recht befestigt. Von
französischer Seite sind einzelne Stimmen schon früh laut geworden,
die Böcklins Bedeutung anerkannten, aber sie blieben ganz vereinzelt.
In England ist der Meister so gut wie unbekannt. Noch heute befindet
sich das Werk des Künstlers mit ganz wenigen Ausnahmen in
deutschem, deutsch-schweizerischem und österreichischem Besitz.
Bezeichnend ist auch, daß die Polemik, die sich vor dem Kriege in
Deutschland gegen Böcklin erhob und ihm jedes wahre Künstlertum
absprach, aus den Kreisen derer stammt, die für die unbedingte
Überlegenheit der Franzosen in der bildenden Kunst eintraten.
Dies alles war nur zum kleineren Teile Zufall. Seine Art ist im letzten
Grunde deutsch. Immer stärker treten in seinem Stil gewisse Neigungen
hervor, die für die Kunst der Festlandgermanen von jeher bezeichnend
gewesen sind, und sie von der der latinisierten Völker unterscheiden. Er
steht diesseits der Kulturgrenze, die vom Jura bis zur Nordsee reicht.
Sein Ideal ist im letzten Grunde nicht die regelnde Ordnung und das
Ebenmaß, sondern das sprühende Leben, die Wucht des Ausdrucks und
die Macht der Stimmung.
DIE VATERSTADT UND DIE ELTERN
Die Vaterstadt Basel ist noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
einem Bewunderer Böcklins, der hingewallfahrtet war, um die Heimat
des Propheten kennen zu lernen, unsäglich eng und muffig erschienen
und von ihm danach verlästert worden. Da mögen unangenehme
Reiseerlebnisse das Urteil getrübt haben, aber früher, in Böcklins
Jugend, hätte ein flüchtiger Besucher wirklich nicht ahnen können, daß
ein enthusiastischer Künstler in den Mauern heranwuchs, der die Faune
und Nymphen, Tritonen und Nereiden und die schaumgeborene
Aphrodite aus dem Orkus heraufholen werde.
Die Stadt war freilich zur Zeit des Humanismus und der Reformation
der Mittelpunkt geistigen Lebens für ganz Südwestdeutschland
gewesen. Sie hatte gleichzeitig auch ein blühendes Kunstleben gehabt.
Dürer hatte auf der Wanderschaft hier Arbeit gefunden und zwanzig
Jahre später Holbein eine zweite Heimat und große und lohnende
Aufträge. Die Buchdrucker datierten damals ihre Drucke aus der
«weitberühmten Stadt Basel» und in den
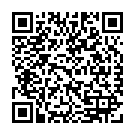
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



