geheiratet und sich
später selbständig gemacht. Das Vermögen der Frau ging freilich in
seinem eigenen Unternehmen zugrunde. Er mußte dann wieder die
technische Leitung einer fremden Fabrik übernehmen, und gerade in
den Jahren, als die Söhne heranwuchsen, hatten sich die Eltern sehr
einzuschränken. Die Mutter gehörte einer alten Basler Familie an, die
schon seit Jahrhunderten von städtischer Kultur verfeinert worden sein
mag. Ihre Mutter war eine Werenfels und Mitglieder dieser Familie
haben sich verschiedentlich ausgezeichnet. Ein Werenfels, wenn auch
nicht ein Vorfahr Böcklins, ist der Schöpfer der glanzvollen
Rokokobauten aus den fünfziger Jahren des 18. Jahrhunderts. Die
erhaltenen Bilder von Böcklins Mutter zeigen eine Physiognomie von
merkwürdig großem Schnitt; sie war eine feine, gebildete, begabte,
wohl direkt bedeutende Frau, die Vertraute ihrer Kinder. Böcklins
Jugend ist keine unglückliche gewesen; er erinnerte sich später gerne
manch drolliger Geschichte aus seinen Knabenjahren. Er hat auch am
städtischen Gymnasium eine tüchtige Schulbildung erhalten und
wenigstens den Julius Cäsar noch im Originaltext gelesen. Einen
wirklich bedeutenden Menschen lernte er hier in dem Germanisten und
Dichter Wilhelm Wackernagel kennen, der neben seiner Tätigkeit an
der Universität auch am Gymnasium Unterricht erteilen mußte, doch
hatte derselbe die Schüler nicht etwa in die Literaturgeschichte
einzuführen, der Unterricht ging lediglich darauf aus, ihnen ein
möglichst gutes Deutsch beizubringen. Böcklin hat auch mit seinen
Brüdern die Zeichenschule besuchen dürfen; nur davon wollte der
Vater nichts wissen, daß er Maler werden sollte. Es gebe schon
hungernde Maler genug. Ein Calame werde er doch noch lange nicht.
Der Widerstand des Vaters war angesichts der eigenen Geldsorgen und
angesichts der Künstlerschicksale, die er vor sich sah, begreiflich. Aber
auch der Sohn hatte etwas von dem Wagemut der alten Eidgenossen
und noch etwas mehr als einst der Vater; er glich ihm überhaupt sehr
und vielleicht am meisten da, wo er ihm unbequem wurde, und der
Entschluß, Maler zu werden, stand bei ihm fest. Die Mutter trat in ihrer
ruhigen und stillen Weise auf des Sohnes Seite und fand eine
Unterstützung bei seinem Lehrer Wackernagel. Sie durfte sich später
wenigstens noch über die ersten äußeren Erfolge des Sohnes, die
Berufung nach Weimar, freuen. Der Vater aber ist erst in dem Jahre
gestorben, als Böcklin seine Toteninsel schuf; er hat also die
glänzendste Schöpfertätigkeit des Sohnes noch miterlebt, indessen er
gerade allem Anschein nach ohne zu ahnen, daß er einen der
bedeutendsten und einflußreichsten Geister des damaligen Europa zum
Sohne hatte; wenigstens äußerte er sich an seinem Lebensabend noch
zu einem jungen Maler, der sich dem Meister angeschlossen hatte, es
sei das Verhängnis seines Sohnes, daß er keinen Rat annehmen wolle.
An Anregungen hat es dem Maler in seiner Jugend nicht gefehlt. Die
Familie wohnte, als er heranwuchs, in einem höchst malerisch
gelegenen säkularisierten Kloster St. Alban, dicht an den grünen Fluten
des Rheins. Kirche und Friedhof des Klosters werden heute noch gerne
gemalt. Bei Basel umgeben die weite Ebene des Rheintals drei Gebirge,
alle drei reich an Naturschönheiten. Offenbar hat der Jura am stärksten
auf Böcklin gewirkt. Die langgezogenen Höhenrücken, die steil
aufragenden Felswände, die malerischen Schluchten, die wundervollen
Buchen- und Tannenwälder und die Burgruinen, die von Berg zu Berg
hinübergrüßen und an eine kriegerische Vergangenheit erinnern, all das
war dazu angetan, die Phantasie des Knaben mächtig anzuregen. Das
Schlichte wirkt oft nachhaltiger als das Glanzvolle. Gewisse Grundzüge
dieser Landschaft scheinen denn auch in berühmten Schöpfungen der
Spätzeit, die im glänzenden Talare südlicher Vegetation auftreten,
wiederzukehren.
Die Gemälde Holbeins, die den stolzen Kunstbesitz der Stadt bildeten,
hingen damals noch in einem Raume der Bibliothek, der nicht
genügend Licht hatte, wie Briefmarken in einem Album dicht
beisammen «bis unter die Decke»; «aber ich hatte gute Augen», meinte
der Meister. Freilich befinden sich unter diesen Meisterwerken nur
wenige, die auf Unvorbereitete tiefen Eindruck zu machen pflegen und
auch das Wenige war--wie man glauben sollte--nicht dazu angetan,
einen geborenen Landschafter anzuregen. Was die Arbeiten
auszeichnete, war die Klarheit der Form und die Feinheit und Schärfe
der Beobachtung, und dennoch, sie haben ihm «sehr gefallen», haben
ihn «sehr interessiert», obwohl, wie er selber hervorhob, Holbeins
Richtung eine andere als die seine gewesen ist.
Von starkem, wenn auch heute im einzelnen gar nicht mehr
abzuschätzendem Einfluß auf das Denken und Fühlen des
heranwachsenden Künstlers war endlich zweifellos die literarische
Bewegung der Zeit (schon sein Zeichenlehrer klagte, Böcklin lese zu
viel), waren auch die mächtigen Wogen der patriotischen Begeisterung,
die in den vierziger Jahren durch die Schweiz gegangen sind. Die Zeit,
in der Böcklin es durchsetzte, Maler werden zu dürfen, fällt zusammen
mit der, da Gottfried Keller erkannte, daß er zum Dichter berufen war.
[Illustration: LANDSCHAFT MIT GEWITTERWOLKEN 1846]
DIE ANFÄNGE SEINER KUNST
Der Beginn der Malerlaufbahn fällt in das Jahr 1845. Im Frühjahr
verließ Böcklin die Schule, im Sommer machte er noch Studien, wie es
scheint, sowohl in den Alpen wie im Jura; im Oktober trat er in die
Düsseldorfer Akademie
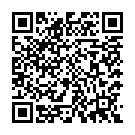
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



