mit den aristotelischen Lehrsätzen, aber sie
verdankten deren Kenntnis, wie es scheint, meist nicht dem Original,
sondern den Arbeiten ihrer italienischen Vorgänger. Dies änderte
sich erst im 17. Jahrh., als der heftige Streit um die "Regeln" in den
Mittelpunkt des literarischen Interesses trat. Mairet, der die erste
"regelrechte" Tragödie, "Sophonisbe", (1629) verfaßte, kannte die
(S. XVII) Poetik aus erster Hand, wie er selbst in der Vorrede zu
"Silvanire" (1626) bezeugt, und dies gilt natürlich auch von den
Führern in der Cid-Kontroverse (1636--1640), wie Chapelain und
_Hedelin d'Aubignac_. Corneille selbst aber scheint sie erst am Ende
seiner dramatischen Laufbahn aus erster Hand kennen gelernt zu haben,
obwohl er in einigen früheren Vorreden zu seinen Dramen
wiederholt auf Aristoteles Bezug nimmt. In seinen drei "Discours"
macht er sodann den freilich vergeblichen Versuch nachzuweisen,
daß seine Tragödien den Lehren der Poetik allenthalben
entsprechen.
Engländern wurde die Poetik durch die Italiener und Franzosen
vermittelt, doch spielte sie bei ihnen nie eine so große Rolle, und
auch diese beschränkte sich fast ausschließlich auf jene drei
"Einheiten." Daß Shakespeare diese kannte, geht aus der Ansprache
an die Schauspieler im Hamlet, den Prologen zu Heinrich V. und dem
"Chorus" der Zeit im Wintermärchen (IV(1)) hervor. Da er sich sonst
ihnen gegenüber noch weit gleichgültiger verhält als seine
dramatischen Zeitgenossen (ein _Marlow, Jonson, Greene, Beaumont_
und _Fletcher_), so möchte ich doch hier nicht unterlassen,
wenigstens auf eine interessante Tatsache hinzuweisen, weil sie bisher
m.W. nicht beobachtet worden ist. Die beiden letzten[4] Dramen aus
seiner Feder sind das "Wintermärchen" und der "Sturm." Während
nun in dem ersteren die "Einheiten" weit gröblicher verletzt werden
als in irgend einem anderen Stücke, hat er diese im "Sturm" und in
ihm allein so streng wie nur irgend möglich durchgeführt. Sollte er
damit haben zeigen wollen, daß für den wahren Dramatiker die
Einhaltung oder die Vernachlässigung der Regeln," (S. XVIII) soweit
die Wirkung in Betracht kommt, gleichgültig ist? Um die Mitte des
17. Jahrh. haben dann Milton, in der Einleitung zu seiner Tragödie
"Samson Agonistes" (1671), und insbesondere Dryden, namentlich in
seinem "Essay über dramatische Poesie" (1668), der aristotelischen
Poetik ein besonderes Interesse zugewandt, letzterer allerdings ganz
unter dem Einfluß von _Corneille Rapin, de Bossu_ und Boileau.
Die Beschäftigung mit unserer Poetik in Deutschland beginnt, wie
erwähnt, mit Lessing. Goethe und durch ihn veranlaßt auch Schiller
(nach 1797) haben sich lebhaft mit ihr befaßt. In ihrem
Gedankenaustausch über die Schrift spiegelt sich die Eigenart der
beiden Dichterfürsten in charakteristischer Weise wieder, doch hat
man die Empfindung, daß in diesem Briefwechsel Schiller durchaus
der Gebende ist. Noch wenige Jahre (1826) vor seinem Tode ist Goethe
in seiner ganz kurzen "Nachlese zur Poetik" nochmals auf den
Gegenstand zurückgekommen, worin er, wohl durch seine
künstlerische Weltanschauung verleitet, eine ganz falsche
Übersetzung des Schlusses der Tragödiendefinition gibt.
Im 19. Jahrh. ist es, von der mächtigen Wirkung der bereits
erwähnten Abhandlung von Bernays abgesehen, vor allem die
Ästhetik, die sich allenthalben mit unserer Poetik auseinandersetzt, so
_E. Müller, Vischer, Volkelt, Günther, Walter, W. Dilthey, Lippe,
Bosanquet, Nietzsche, Baumgart_ und _Carrière_, um nur diese zu
nennen. In den Hauptfragen wie über den Ursprung der Poesie, den
Begriff des Kunstschönen, den Endzweck der Dichtung, sind manche
dieser Forscher zwar zu neuen und eigenartigen aber im großen und
ganzen keineswegs einwandfreieren oder sichereren Ergebnissen
gelangt, als sie schon in den kurzen, fast ohne Begründung
hingeworfenen (S. XIX) Lehrsätzen des Aristoteles uns vorliegen.
* * * * *
5. Die Quellen der Poetik.
Originalität ist ein rein relativer Begriff, ja in einem gewissen Sinne
gibt es eine solche überhaupt nicht, ist doch jeder Denker ein Erbe
der Vergangenheit[5] und irgendwie von Vorgängern, wenn nicht
direkt abhängig, so doch, und zwar oft unbewußt, beeinflußt.
Andrerseits steckt nicht minder häufig in der Art, wie ein Forscher
den ihm vorliegenden Stoff verarbeitet, in der Beleuchtung, in die er
ihn rückt, in dem Zusammenhang in den er ihn einreiht oder, falls er
sich mit ihm im Widerspruch befindet, in der Begründung seines
entgegengesetzten Standpunkts ein ebenso hoher Grad von
Selbständigkeit und Originalität als in dem ganz Neuen, das er im
übrigen bringen mag. So ist denn zweifellos auch die Poetik des
Aristoteles nicht wie Athene in voller Rüstung aus dem Haupte des
Zeus entsprungen, auch er hat, und zwar nachweisbar, eine
umfangreiche Literatur über seinen Gegenstand, vor allem in den
Schriften der Sophisten, schon vorgefunden und so weit zweckdienlich
verwertet oder auch zu widerlegen sich veranlaßt gefühlt. Gegen
das Verdammungsurteil, das Platon gegen das Epos und Drama
geschleudert hat, bildet die Poetik als Ganzes gleichsam einen
stillschweigenden Protest, der in einer Anzahl Stellen sogar deutlich
und greifbar hervortritt, obwohl er den Namen seines Lehrers niemals
nennt.
Daß einzelne Gedankengänge Platons über die Dichtkunst (S.
XX) auf Aristoteles eingewirkt, seinen Theorien eine gewisse Richtung
gegeben und ihn bewogen haben zu ihm seinerseits Stellung zu nehmen,
ist fast selbstverständlich und allgemein anerkannt.
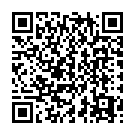
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



