1--8.
B. _Das Epos_: c. 23--c. 24.
1. Einheit und Umfang des Epos. Vorzüge Homers: c. 23-24, 4.
2. Einheitliches Versmaß: c. 24, 5.
3. Weitere homerische Vorzüge: c. 24, 6.
4. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Epos und Tragödie in der
Behandlung gleichzeitiger Ereignisse: c. 24, 7.
5. Homer als Lehrer der zweckmäßigen Lüge (dichterische
Illusion): c 24, 8.
6. Das Vernunftwidrige im Epos: c. 24, 9.
7. Der sprachliche Ausdruck im Epos: c. 24, 10.
C.[2] Die _fünf Probleme_ (kritischen Einwendungen) in einem
Dichtwerk und deren _zwölf Lösungen_ (Widerlegungen,
Rechtfertigungen): c. 25, 1--22.
(I.) Das _Unmögliche_: 1. Es entspricht dem Zwecke der Kunst. 2. Es
betrifft Unwesentliches, Zufälliges. (II.) Das Vernunftwidrige oder
Unwahrscheinliche. 3. Es hätte so sein sollen (Idealisierung). 4. Es
entspricht dem allgemeinen Glauben. 5. Es ist historisch beglaubigt.
(III.) Das _moralisch Schädliche_. 6. Der an das Sittliche zu legende
Maßstab ist ein relativer. (IV.) Das Widerspruchsvolle. 7. Auf Grund
des dialektischen Verfahrens zu lösen.
(V.) _Verstoß gegen die Kunstrichtigkeit_. (s. X) 8. Auf Grund der
Annahme einer Glosse oder Metapher. 9. Der Prosodie (Akzent und
Spiritus). 10. Der Interpunktion. 11. Der Amphibolie (Doppelsinn). 12.
Des Sprachgebrauchs.
D. Warum die Tragödie vor dem Epos den Vorzug verdient: c. 26,
1--9 */
* * * * *
EINLEITUNG
* * * * *
1. Die Bedeutung der Poetik.
Es gibt kein Werk gleich geringen Umfangs, das sich (s. XI) auch nur
entfernt mit dem Einfluß messen kann, den die aristotelische Poetik
Jahrhunderte lang ausgeübt hat. Freilich werden wir heute nicht mehr,
wie einst Lessing, deren Lehren für ebenso unfehlbar halten wie die
Elemente des Euklid. Im Gegenteil, man wird ohne weiteres zugeben
müssen, daß für die Dramatiker der Gegenwart--das Epos
kommt nicht in Betracht da es ganz in dem Roman aufgegangen
ist--Aristoteles als literarischer Gesetzgeber ein völlig
überwundener Standpunkt ist.
Andrerseits ist es aber nicht minder wahr, daß auch heute noch
niemand der Kenntnis der Poetik schadlos entraten kann, der auch nur
oberflächlich sich mit den Literaturen, namentlich Italiens,
Frankreichs und Englands vom 16. bis etwa zur Mitte des 18. Jahrh.,
beschäftigen will. Und ebensowenig darf der Ästhetiker, der
literarische Kritiker oder Literarhistoriker an diesem Büchlein
achtlos vorübergehen, sollen seine rein theoretischen Darlegungen
über viele in das Gebiet der Dichtkunst einschlägige Probleme
nicht von vornherein einer wichtigen Grundlage entbehren. Was
vollends dem klassischen Philologen die Poetik des Aristoteles ist und
stets sein wird, bedarf keines weiteren Wortes.
* * * * *
2. Die Poetik im Altertum.
Unter diesen Umständen mag es auf den ersten Blick sehr befremden,
daß sich im Altertum selbst bisher keine sicheren Spuren einer aus
erster Hand geschöpften Kenntnis, geschweige denn eines Einflusses
der aristotelischen (S. XII) Poetik haben nachweisen lassen. Dagegen
spricht auch nicht eine Anzahl direkter Zitate bei späten Erklärern
des Aristoteles, zumal man nicht einmal ohne weiteres annehmen darf,
daß jene Stellen nicht einfach den von ihnen ausgeschriebenen,
älteren Quellen entlehnt sind.
Zur Erklärung dieser bemerkenswerten Tatsache mag vielleicht
folgendes dienen. Zunächst scheint unsere Poetik überhaupt zuerst
von Andronikos v. Rhodos, einem Zeitgenossen Ciceros, zusammen
mit anderen Werken des Aristoteles in Rom herausgegeben worden zu
sein. Horaz, bzw. sein viel älterer Gewährsmann, Neoptolemos v.
Parion (c. 260 v. Chr.), zeigt trotz mancher sachlichen
Ãœbereinstimmungen keine direkte Benutzung der Schrift und
dasselbe gilt von einem uns nur in Bruchstücken erhaltenen,
umfangreichen Werke "Ãœber die Dichtungen", dessen Verfasser
Philodemos v. Gadara zum Freundeskreise des Horaz gehörte.
Sodann brachten die Griechen der römischen Kaiserzeit der Poesie
überhaupt nicht das geringste Interesse entgegen. Ist uns doch aus
dieser ganzen Epoche keine einzige Tragödie auch nur dem Titel nach
bekannt. An die Stelle der Komödie waren der dramatische, aber
literarisch wertlose Mimus und der Pantomimus getreten und die
wenigen uns meist erhaltenen Epen, wie die des Oppian, _Quintus
Smyrnaeus, Claudian, Kolluthos, Triphiodor_, ja selbst des Nonnos,
stammen aus sehr später Zeit und kommen als echte Kunstwerke
überhaupt nicht in Betracht, wie sie denn auch von den Lehren des
Aristoteles keinen Hauch verspüren lassen. Es darf daher nicht
Wunder nehmen, daß eine wissenschaftliche Technik des Dramas
und des Epos, wie unsere Poetik, keinerlei Beachtung fand oder finden
konnte. Diese der Dichtkunst allenthalben entgegengebrachte
Gleichgültigkeit wird es wohl auch (S. XIII) zum Teil verschuldet
haben, daß zahlreiche andere literargeschichtliche Werke des
Aristoteles ganz verloren gingen. So vor allem die "Didaskalien", eine
vollständige Liste aller in Athen aufgeführten Dramen, der
reichhaltige Dialog "Ãœber die Dichter" in 3 B., von dem uns noch
einige Bruchstücke mannigfachen Inhalts erhalten sind, und die
"Pragmateia (Untersuchung der Dichtkunst", in 2 B. In dieser wird
Aristoteles das, was in dem unvollständig auf uns gekommenen
Kollegienheft skizzenhaft entworfen oder zwecks weiterer
mündlicher Ausführung nur angedeutet war, erschöpfend, wie
wir es bei ihm gewohnt sind, behandelt haben. Unsere Poetik verdankt
ihre Erhaltung wohl nur dem glücklichen Umstand, daß sie als
Anhängsel der Rhetorik oder der Logik, die als Schulfächer
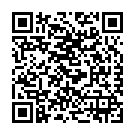
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



