Mark jährlich, wobei indes gleich vorzumerken ist, daß nach der
Einkommenstatistik für Preußen und Sachsen über 70 Proz. der
Bevölkerung dieser Staaten dieses durchschnittliche Einkommen noch
nicht, und ungefähr 50 Proz. noch nicht die Hälfte davon erreicht.
Hierbei ist aber alles Zins- oder Renteneinkommen bei denen, die
dergleichen haben, mitgerechnet. Nach Abzug desselben in der vorher
angenommenen Höhe verbleibt mithin für die ganze eigentliche
Arbeitstätigkeit des Deutschen Volkes nur ein Netto-Ertrag, der
wiederum gleichmäßig verteilt gedacht, pro Familie höchstens 1000
Mark jährlich abwirft -- alles eingeschlossen, was nicht reiner Zins ist,
also außer dem gewöhnlichen Arbeitslohn auch die Gehälter aller
öffentlichen und Privat-Beamten und aller Unternehmer- und
Handelsgewinn.
Die Verzinsung des Nationalvermögens beansprucht hiernach zurzeit in
Deutschland vorweg ein Drittel der gesamten durch die Verbindung
von Kapital und Arbeit bedingten Werterzeugung und läßt nur zwei
Drittel davon als Entgelt für die Arbeitstätigkeit selbst übrig. Mithin hat
die Gesamtheit aller Arbeitenden in allen Tätigkeitsgebieten, dem
Durchschnitt nach, immer zwei Tage in der Woche zu arbeiten für die
Gesamtheit der Besitzenden, d. h. derer, welche Miteigentümer des
Nationalvermögens sind, dessen Verzinsung vorweg aufgebracht
werden muß. Denn zur Bemessung des durchschnittlichen Anteils der
einzelnen an dieser Leistung der Gesamtheit gibt es keinen andern
Maßstab als den relativen Wert den die Arbeit der einzelnen für sie
selbst hat.
Es gehört nicht hierher, die sehr mannigfaltigen und verwickelten
Wege zu betrachten, auf welchen in den verschiedenen Klassen der
Arbeitstätigen der einzelne seine Zinsabgabe direkt oder indirekt leistet,
auch wenn er selbst gar keine Schulden hat. Sozialpolitisch hat nur das
Endresultat Bedeutung, welches das Verhältnis zwischen Arbeit und
Kapital für die Gesamtheit der Arbeitenden gegenüber der Gesamtheit
der Besitzenden zum Ausdruck bringt. Ich erwähne also nur noch, daß
die zuvor charakterisierte Tributpflichtigkeit der Arbeit alle betrifft,
soweit sie in irgend einer Form arbeitstätig sind -- alle vom letzten
Tagelöhner bis zu den obersten Staatsbeamten. Auch die Staatsbeamten
haben ihren Anteil redlich zu leisten in einer zwar ganz mittelbaren,
aber gerade sehr charakteristischen Form. Abgesehen von den wenigen,
welchen die Staatsraison eine repräsentative Lebenshaltung nach dem
Vorbild der Reichsten zuweist, kann auch den Beamten der arme
Teufel »Staat« von sechs Tagen, welche sie arbeiten, nur die bewußten
vier Tage wirklich bezahlen; denn nachdem alles Arbeitseinkommen
der Bürger durch die Vorwegnahme der Zinsquote schon stark
herabgedrückt ist, können Steuern, welche wiederum fast ganz an
dieses Arbeitseinkommen sich halten, unmöglich noch in genügender
Höhe auferlegt werden, um den Beamten des Staats eine befriedigende
Bezahlung zu sichern.
Das zuvor charakterisierte Verhältnis von Arbeit und Besitz gewinnt
seine soziale Bedeutung natürlich nur in Verbindung mit der Tatsache
der äußerst ungleichmäßigen -- und nach dem jetzigen Lauf der Dinge
noch immer ungleichmäßiger werdenden -- Verteilung des Besitzes.
Eine solche Bedeutung würde ihm gar nicht zukommen, wenn das
Gesamtvermögen des Volkes auf die Individuen in den verschiedenen
Volksschichten durchschnittlich sich verteilte proportional dem Werte
persönlicher Arbeitsleistung in diesen Schichten. Alsdann wäre jeder
sein eigener Zinsherr, nähme den auf ihn entfallenden Anteil an der
gemeinsamen Tributleistung selbst wieder in Empfang, und als
sozialpolitisch erhebliches Moment bliebe nur noch die Ungleichheit
des Wertes der Arbeitsleistung in den verschiedenen Volkskreisen
übrig. Die Wirklichkeit aber ist ungeheuer weit entfernt von einer
derartigen Bilanz. Zwar gibt es nur verhältnismäßig wenige, welche gar
keinen, auch nicht den kleinsten, Anteil am Nationalvermögen hätten,
noch nicht einmal den notdürftigsten Betriebsfonds für eine kleine
Hauswirtschaft; sehr gering aber ist auch der Prozentsatz solcher, für
welche -- soweit es Arbeitstätige sind -- die Renteneinnahme,
einschließlich der Ersparnis von Ausgabeposten infolge eigenen
Besitzes, einen nennenswerten Zuschuß zum Arbeitseinkommen
ausmacht, sei es auch nur viel weniger als die normalen 50 Proz.
Tatsächlich bedeutet das vorher gekennzeichnete Verhältnis: effektive
Abgabe einer größeren oder geringeren Quote des natürlichen
Arbeitsertrags seitens der großen Majorität der Arbeitstätigen an die
kleine Minorität derjenigen Miteigentümer am Nationalvermögen,
welche die großen Brocken desselben inne haben. Mindestens 80 Proz.
des ganzen Volkes ist gegenwärtig tributpflichtig geworden zugunsten
der obersten 5 Proz.
Welche Wirkungen aber dieser Zustand mit sich bringt, liegt klar genug
zutage.
Die Herabminderung des durchschnittlichen effektiven Arbeitsertrages
durch den Abzug der Zinsquote drückt relativ am stärksten die
untersten Volksklassen, weil jede Minderung des Einkommens um so
härter wirkt, je weniger seine absolute Höhe die Erfordernisse der
notdürftigsten Lebensführung überschreitet. In diesen untersten
Volksklassen ist aber gerade die weitaus größte Majorität der
unselbständigen Arbeiter enthalten, deren Arbeitsertrag noch einem
zweiten Abzug zugunsten des »Unternehmergewinns« unterliegt --
kraft der wirtschaftlichen Verhältnisse, auf welche mein zweites
Referat sich beziehen wird. So ergibt sich also eine starke
Herabsetzung des sonst möglichen durchschnittlichen Niveaus der
Lebenshaltung der breiten Volksschichten. Je weniger nun die
herabgesunkene Lebenshaltung der Ärmsten ihnen noch einen
indirekten Vorteil von der Steigerung des Wohlstandes der Reichen
übrig läßt, desto mehr gewinnt ihre fortdauernde Beitragsleistung zur
Zinsquote des Gesamtvermögens die Bedeutung und den Charakter der
reinen Frone.
Weitere sehr verhängnisvolle Wirkungen ergeben sich auf Grund des
Umstandes,
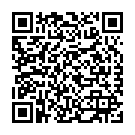
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



