besten Beispiele altchristlicher Elfenbeinplastik. Die
Ausartung derselben in flüchtige Roheit zeigt das Bruchstück einer
anderen Pyxis (No. 430) mit einer Darstellung des kleinen Joseph
zwischen seinen Brüdern, die wohl erst dem VI. Jahrh. angehört. Für
den Einfluß, den die allmählich aus der Antike sich eigenartig
entwickelnde byzantinische Kunst schon damals von Ravenna aus auf
einzelne Teile von Italien ausübte, ist das große Diptychon mit dem
thronenden Christus zwischen Petrus und Paulus und mit Maria
zwischen zwei Engeln (No. 428 und 429) ein besonders
charakteristisches, vorzügliches Beispiel. Die Arbeit stimmt mit den
Elfenbeinreliefs am Throne des Maximian ({~DAGGER~} 556) in
Ravenna überein und darf daher als gleichzeitige Arbeit eines Künstlers
in Ravenna gelten.
Die romanische Epoche (um 600 bis 1250).
[Abbildung: 4. Sarkophag aus Venedig.]
Nach den furchtbaren Verheerungen und Plagen, mit welchen Italien
seit der Zertrümmerung des weströmischen Reiches in verstärktem
Maße heimgesucht wurde, war die Begründung des
Longobardenreiches eine erste, wenn auch nur schwache und kurze
Erholung für das verwüstete, menschenleere Land. In solchen Nöten
hatten die Künste keine Pflege finden können, waren selbst die Keime
erstickt, aus denen sich Neues hätte entwickeln können. Aber auch
nach der Aufrichtung des Longobardenreiches verging fast ein halbes
Jahrtausend unter fortwährendem politischen Elend, bis in Italien der
Boden für eine nationale Kunstentwickelung wieder bestellt war.
Freilich war das Bedürfnis zu künstlerischer Ausgestaltung und
Ausschmückung der Umgebung, namentlich der Gotteshäuser, selbst in
dieser kunstarmen, unkünstlerischen Zeit nicht erloschen; und wo
höhere Anforderungen gestellt wurden, mußte man sich an das Ausland
wenden. Schon die ersten unter den Longobardenkönigen zogen daher
byzantinische Künstler an ihren Hof, und später sehen wir wiederholt in
den verschiedensten Teilen von Italien, namentlich in Venedig und
Süditalien, byzantinische Künstler eine hervorragende Thätigkeit
entfalten. Regelmäßig wiederholt sich dabei dieselbe Erscheinung: die
Vorbilder, welche diese fremden Künstler schufen, wurden barbarisch
nachgeahmt, ohne daß sich daran eine eigenartige lebensfähige
Kunstthätigkeit anzuschließen im Stande war.
Besonders tief ist in diesem langen Zeitraume der Stand der
bildnerischen Kunst. Hier wirkte noch der Umstand sehr ungünstig ein,
daß die der figürlichen Plastik abholden Byzantiner fast nur nach der
ornamentalen Seite Vorbilder lieferten. Diese byzantinische und
byzantinisierende Dekorationsweise trägt den Charakter einer
teppichartigen Flächendekoration, welche Wandfüllungen, Ballustraden,
Kapitelle u. s. f. vollständig bedeckt. Gewinde von Weintrauben oder
Epheu, Akanthusblätter und Akanthusranken umgeben Krucifixe,
Rosetten oder Tiere mit symbolischer Beziehung, oder bilden den
Grund, auf dem sich dieselben abheben. Auch das aus dem Norden
Europa's stammende Bandgewinde, phantastisch und oft sehr zierlich
verschlungen, hat sich hier eingefunden. Wo diese Ornamente rein und
gut gearbeitet sind, dürfen wir, nach dem Vergleich mit erhaltenen
Arbeiten im Gebiete des alten byzantinischen Reiches, auf die Hand
von byzantinischen Künstlern schließen. Besonders reiche und gute
Beispiele der Art bieten Rom, Brescia und namentlich Venedig und
Torcello. Von letzteren besitzt auch die Berliner Sammlung, aus der
1841 erworbenen Sammlung Pajaro, eine Anzahl interessanter Stücke,
welche teils noch von dem alten Markusdom (aus dem Jahre 829, so
das Fenster No. 2 und die Muscheldekoration No. 6), teils von dem
Umbau nach einem Brande im Jahre 976 herrühren; von letzterem ein
Paar Kapitelle (No. 8 und 9) u. a. m. Die Pfauen am Brunnen (No. 7)
aus frühester byzantinischer Zeit. Auch die seltenen feineren Arbeiten
der kleinen Plastik: Altarvorsätze in edlen Metallen, Elfenbeinarbeiten,
namentlich die Kästchen mit Einzelfiguren von Kämpfern u. dergl.,
sind regelmäßig Arbeiten byzantinischer Künstler, die im IX. und X.
Jahrh. in Italien beschäftigt waren.
Weit zahlreicher und über ganz Italien zerstreut sind die italienischen
Nachbildungen solcher byzantinischer Vorbilder in Stein, die durch den
Mangel an Originalität der Erfindung und an dekorativem Sinn, wie
durch auffallende Roheit der Ausführung sich unschwer als Arbeiten
einheimischer Steinmetzen kennzeichnen. Neben Venedig und seinen
Nachbarorten sind Cividale, Ancona, Rom mit Bauten, an denen
dekorative Bildwerke dieser Art ursprünglich oder von älteren
Monumenten angebracht sind, besonders reich; sie finden sich aber
auch bis nach Sicilien hinein. Das Berliner Museum hat von solchen
Arbeiten namentlich ein Paar interessanter Sarkophage (No. 3 und 4)
und einen Thürbogen (No. 5) aufzuweisen, die dem VIII. und IX. Jahrh.
anzugehören scheinen.
Erst im XI. Jahrh. beginnt langsam aber stetig und fast gleichzeitig in
verschiedenen Teilen Italiens eine nationale Kunst wieder einzusetzen;
zunächst in der Architektur, welche allmählich auch die Plastik zu ihrer
Beihülfe heranzieht. Dieselbe erstarkt während des XII. Jahrh. im
gesunden Anschluß an die Baukunst und gelangt um die Mitte des XIII.
Jahrh. zu einer selbständigen künstlerischen Entfaltung. Für den
Verlauf dieser Entwickelung in den einzelnen Teilen Italiens ist
namentlich der verschiedene Einfluß maßgebend, der von außen auf die
bildnerische Thätigkeit einwirkt. In Venedig und seiner Nachbarschaft
bleiben für lange Zeit noch die Vorbilder der byzantinischen Bildwerke
der Ausgangspunkt für die einheimische Plastik. In Süditalien und
Sicilien sind gleichfalls byzantinische Künstler noch bis in das XII.
Jahrh. thätig; neben ihnen macht sich aber auch arabischer Einfluß in
eigentümlicher Weise geltend. Unabhängiger von der östlichen Kunst
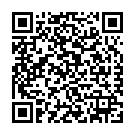
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



