Die Italienische Plastik
The Project Gutenberg EBook of Die Italienische Plastik, by Wilhelm
Bode This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Die Italienische Plastik
Author: Wilhelm Bode
Release Date: July 1, 2006 [EBook #18733]
Language: German
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DIE
ITALIENISCHE PLASTIK ***
Produced by Juliet Sutherland, Sigal Alon, Roger Frank and the Online
Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net
Anmerkungen zur Transkription:
Im Original steht hier "altitalischen" anstatt "altitalienisch". Im Original
steht hier "italischer" anstatt "italienischer". Im Original steht hier
"süditalischen" anstatt "süditalienischen". Im Original steht hier "Eine"
anstatt "eine". Im Original steht hier "Forsetzung" anstatt "Fortsetzung".
Im Original steht hier "Ein" anstatt "ein". Im Original steht hier "Aller"
anstatt "aller". Im Original steht hier "norditalischen" anstatt
"norditalienischen". Im Original steht hier "Jahrzente" anstatt
"Jahrzehnte". Im Original steht hier "süditalische" anstatt
"süditalienische". Im Original steht hier "oberitalischen" anstatt
"oberitalienischen". Im Original steht hier "Querzia" anstatt "Quercia".
Im Original steht hier "Einem" anstatt "einem".
HANDBÜCHER DER KÖNIGLICHEN MUSEEN ZU BERLIN MIT
ABBILDUNGEN
DIE ITALIENISCHE PLASTIK
VON
WILHELM BODE
MIT 86 ABBILDUNGEN IM TEXT
ZWEITE AUFLAGE
BERLIN W. SPEMANN 1893
Altchristliche Plastik (um 300 bis 600 n. Ch.).
[Abbildung: 1. Bronzestatuette des hl. Petrus]
Das Auftreten und der schließliche Sieg des Christentums, welches die
alte Welt zertrümmerte und eine neue Kultur an seine Stelle setzte, hat
zur Belebung der Kunst zunächst nicht beigetragen. Die künstlerische
Schöpfungskraft war im weströmischen Reiche zur Zeit Konstantin's
schon völlig erloschen; die Kunst, zumal die bildnerische, die recht
eigentlich die Kunst der Antike gewesen war, zehrte von Traditionen,
welche mehr und mehr verblaßten; und in den immer roheren und
empfindungsloseren, immer spärlicheren Nachbildungen verlor sich
allmählich auch die handwerksmäßige Fertigkeit. Für den Bronzeguß
fehlte es, von Werken der Kleinkunst abgesehen, an Ausdauer und
technischem Können, für die Ausführung von Freifiguren überhaupt an
künstlerischem Vermögen; die bildnerische Thätigkeit wurde daher
bald auf das Relief beschränkt, und auch dieses wurde vorwiegend im
Kleinen ausgeführt.
Die christliche Religion war schon an sich für die plastische Gestaltung
ihrer Ideen und Personen wenig geeignet, sie war ihr auch durch ihren
Zusammenhang mit dem mosaischen Gesetz abgeneigt; in Folge dessen
wurde die Plastik von den großen monumentalen Werken, welche die
Anerkennung des Christentums als Staatsreligion notwendig machte, so
gut wie ganz ausgeschlossen. Aber auch der greisenhafte Zustand der
Zeit, das Fehlen jeder erfinderischen Kraft für die neuen künstlerischen
Aufgaben, welche durch das Christentum und die christliche
Staatskirche erwuchsen, machte ein Zurückgehen auf antike Vorbilder
und teilweise selbst auf antike Motive, ja eine knechtische Entlehnung
derselben notwendig. Selbst die Aufgaben blieben im Grunde die alten;
man erfüllte sie nur mit neuem Geist.
[Abbildung: 427. Elfenbeinpyxis]
In erster Linie steht, als Ausfluß des tiefgewurzelten altitalienisch
Totenkultus, der Schmuck der Sarkophage; daneben die kleine Plastik,
namentlich die Elfenbeinschnitzerei und der Schmuck der Lampen, die
in den Katakomben eine reiche Verwendung zu heiligen Zwecken
fanden. Bei der Ausführung dieser Bildwerke schlössen sich die
Künstler den heidnischen Vorbildern unmittelbar an; Stil und Technik
blieben dieselben, verloren aber schließlich auch den letzten
Zusammenhang mit der Natur. Zur Schöpfung heiliger Typen, wie sie
der neue Glaube erfordert hätte, war eine solche Plastik nicht mehr
befähigt. Für Christus und einige der vornehmsten Apostel, namentlich
Petrus, hatte die historische Tradition in der vorausgegangenen Zeit die
Vorbilder festgestellt; im Übrigen sind fast alle anderen Gestalten
schemenhafte Nachbildungen heidnischer Vorbilder. Die Einzelfigur
trat zurück; das erzählende Relief, von der Malerei abhängig und ein
notdürftiger Ersatz derselben, wurde fast ausschließlich, wie in den
Anfängen der Kunst, eine bildliche Erläuterung des neuen Glaubens.
Diese aus spätrömischer Tradition herausgewachsene und in römischer
Form und Auffassungsweise in die Erscheinung tretende Kunstübung,
die als altchristliche Kunst bezeichnet wird, starb langsam ab unter den
Stürmen der Völkerwanderung, in denen das weströmische Reich durch
deutsche Völkerschaften zertrümmert wurde, die nicht im Stande waren,
dauerhafte Zustände an die Stelle zu setzen.
[Abbildung: 429. Elfenbeintafel.]
Die Werke italienischer Plastik aus dieser Zeit, die überhaupt spärlich
sind, haben nur selten ihren Weg aus Italien herausgefunden; was sich
im Auslande findet, gehört fast ausnahmslos der Kleinkunst an;
vorwiegend sind es Werke der Elfenbeinplastik. Die Berliner
Sammlung besitzt, als große Seltenheit, die kleine Freifigur eines
Petrus aus Bronze (No. 1); eine Arbeit des IV. Jahrh., die durch ihren
unmittelbaren Anschluß an eine antike Rednerstatue, trotz der rohen
Bildung der Extremitäten, noch eine gewisse Lebendigkeit in der
Haltung und im Ausdruck besitzt. Ebenso rein antik erscheint die
gleichzeitig entstandene Elfenbeinpyxis mit der Darstellung Christi
zwischen den Aposteln und dem Opfer Abrahams (No. 427), die, Dank
der leichteren Bearbeitung des Materials, feiner in der Durchbildung ist;
sie ist eines der
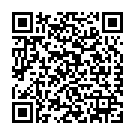
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



