es möglich, Posen und das Rheinland ohne
Schädigung ihrer wirtschaftlichen Eigenart derselben wirtschaftlichen
Gesetzgebung zu unterwerfen, so war schon erwiesen, daß diese
Gesetze mit einigen Änderungen auch für Baden und Hannover
genügen mußten. Preußen hatte sich -- so sagte Maaßen oftmals --
genau die nämlichen Fragen vorzulegen wie alle die anderen deutschen
Staaten, welche ernstlich nach Zolleinheit verlangten, und konnte,
wegen der Mannigfaltigkeit seiner wirtschaftlichen Interessen, leichter
als jene die richtige Antwort finden. Aber die Ausführung des
Gedankens, die Verlegung der Zölle an die Grenzen des Staates war in
Preußen schwieriger als in irgendeinem anderen Reiche; sie erschien
zuerst vielen ganz unausführbar. Man sollte eine Zollinie von 1073
Meilen bewachen, je eine Grenzmeile auf kaum fünf Geviertmeilen des
Staatsgebiets, und zwar unter den denkbar ungünstigsten Verhältnissen,
da die kleinen deutschen Staaten, die mit dem preußischen Gebiete im
Gemenge lagen, zumeist noch kein geordnetes Zollwesen besaßen, ja
sogar den Schmuggel grundsätzlich begünstigten. Solche Bedrängnis
veranlaßte die preußischen Finanzmänner zur Aufstellung eines
einfachen übersichtlichen Tarifs, der die Waren in wenige große
Klassen einordnete. Eine umfängliche, verwickelte Zollrolle, wie sie in
England oder Frankreich bestand, erforderte ein zahlreiches
Beamtenpersonal, das in Preußen den Ertrag der Zölle verschlungen
hätte. Durch denselben Grund wurde Maaßen bewogen, die Erhebung
der Zölle nach dem Gewichte der Waren vorzuschlagen, während in
allen anderen Staaten das von der herrschenden Theorie allein
gebilligte System der Wertzölle galt. Die Abstufung der Zölle nach
dem Werte würde die Kosten der Zollverwaltung unverhältnismäßig
erhöht haben; zudem lag in der hohen Besteuerung kostbarer Waren
eine starke Versuchung zum Schmuggelhandel, welche ein Staat von so
schwer zu bewachenden Grenzen nicht ertragen konnte.
Auch in der großen Prinzipienfrage der Handelspolitik gab die
Rücksicht auf die Finanzen den Ausschlag. Der Staat hatte die Wahl
zwischen zwei Wegen. Man konnte entweder nach Englands und
Frankreichs Beispiel Prohibitivzölle einführen, um diese sodann als
Unterhandlungsmittel gegen die Westmächte zu benutzen und also Zug
um Zug durch Differentialzölle zur Erleichterung des Verkehrs zu
gelangen; oder man wagte sogleich in Preußen ein System mäßiger
Zölle zu gründen, in der Hoffnung, daß die Natur der Dinge die großen
Nachbarreiche dereinst in dieselbe Bahn drängen werde. Maaßen fand
den Mut, den letzteren Weg zu wählen, vornehmlich, weil der
zweifelhafte Ertrag aus hohen Schutzzöllen dem Bedürfnis der
Staatskassen nicht genügen konnte. Verboten wurde allein die Einfuhr
von Salz und Spielkarten; die Rohstoffe blieben in der Regel
abgabenfrei oder einem ganz niedrigen Zolle unterworfen. Von den
Manufakturwaren sollte ein mäßiger Schutzzoll erhoben werden, nicht
über 10 Prozent, ungefähr der üblichen Schmuggelprämie entsprechend.
Die Kolonialwaren dagegen unterlagen einem ergiebigen Finanzzolle,
bis zu 20 Prozent, da Preußen an seiner leicht zu bewachenden
Seegrenze die Mittel besaß, diese Produkte wirksam zu besteuern.
Dies freieste und reifste staatswirtschaftliche Gesetz des Zeitraums
wich von den herrschenden Vorurteilen so weit ab, daß man im
Auslande anfangs über die gutmütige Schwäche der preußischen
Doktrinäre spottete. Den Staatsmännern der absoluten Monarchie fällt
ein undankbares entsagungsvolles Los. Wie laut preist England heute
seinen William Huskisson(3), *one of the world's great spirits*; alle
gesitteten Völker bewundern die Freihandelsreden des großen Britten.
Der Name Maaßens aber ist bis zur Stunde in seinem eigenen
Vaterlande nur einem engen Gelehrtenkreise vertraut. Und doch hat die
große Freihandelsbewegung unseres Jahrhunderts nicht in England,
sondern in Preußen ihren ersten bahnbrechenden Erfolg errungen. Das
wiederhergestellte französische Königtum hielt in dem Tarife von 1816
die strengen napoleonischen Prohibitivzölle gegen fremde Fabrikwaren
hartnäckig fest. Die Selbstsucht der Emigranten fügte noch schwere
Zölle auf die Erzeugnisse des Landbaues, namentlich auf Schlachtvieh
und Wolle, hinzu. Auch in England war nur ein Teil des
Handelsstandes für die Lehren der Verkehrsfreiheit gewonnen. Noch
stand der Grundherr treu zu den hohen Kornzöllen, der Reeder zu
Cromwells Navigationsakte(4), der Fabrikant zu dem harten
Prohibitivsysteme; noch urteilte die Mehrzahl der Gebildeten wie einst
Burke(5) über Adam Smith: solche abstrakte Theorien sind gut genug
für das stille Katheder von Glasgow(6). Erst das kühne Vorgehen der
Berliner Staatsmänner ermutigte die englischen Freihändler, mit ihrer
Meinung herauszurücken. Auf das »glänzende Beispiel, welches
Preußen der Welt gegeben«, berief sich die freihändlerische Petition
der Londoner City, welche Baring im Mai 1820 dem Parlamente
übergab. An Preußen dachte Huskisson, als er seinen berühmten Satz
aufstellte: »Der Handel ist nicht Zweck, er ist das Mittel, Wohlstand
und Behagen unter den Völkern zu verbreiten« und seinem Volke
zurief: »Dies Land kann nicht still stehen, während andere Länder
vorschreiten in Bildung und Gewerbefleiß«.
Den freihändlerischen Ansichten der preußischen Staatsmänner
genügte das neue Gesetz nicht völlig. Man ahnte im Finanzministerium
wohl, daß der weitaus größte Teil des Zollertrags allein von den
gangbarsten Kolonialwaren aufgebracht werden und die Staatskasse
von anderen Zöllen nur geringen Vorteil ziehen würde. Aber man sah
auch, daß jedem Steuersystem durch die Gesinnung der
Steuerpflichtigen feste Schranken gezogen sind; die öffentliche
Meinung jener Tage würde der Regierung nie verziehen haben, wenn
sie den Kaffee besteuert, den Tee frei gelassen hätte.
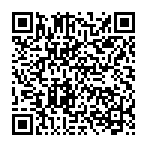
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



