bewusst. So
bilden sich angewöhnte rasche Verbindungen von Gefühlen und
Gedanken, welche zuletzt, wenn sie blitzschnell hinter einander
erfolgen, nicht einmal mehr als Complexe, sondern als Einheiten
empfunden werden. In diesem Sinne redet man vom moralischen
Gefühle, vom religiösen Gefühle, wie als ob diess lauter Einheiten
seien: in Wahrheit sind sie Ströme mit hundert Quellen und Zuflüssen.
Auch hier, wie so oft, verbürgt die Einheit des Wortes Nichts für die
Einheit der Sache.
15.
Kein Innen und Aussen in der Welt. - Wie Demokrit die Begriffe Oben
und Unten auf den unendlichen Raum übertrug, wo sie keinen Sinn
haben, so die Philosophen überhaupt den Begriff "Innen und Aussen"
auf Wesen und Erscheinung der Welt; sie meinen, mit tiefen Gefühlen
komme man tief in's Innere, nahe man sich dem Herzen der Natur.
Aber diese Gefühle sind nur insofern tief, als mit ihnen, kaum
bemerkbar, gewisse complicirte Gedankengruppen regelmässig erregt
werden, welche wir tief nennen; ein Gefühl ist tief, weil wir den
begleitenden Gedanken für tief halten. Aber der tiefe Gedanke kann
dennoch der Wahrheit sehr fern sein, wie zum Beispiel jeder
metaphysische; rechnet man vom tiefen Gefühle die beigemischten
Gedankenelemente ab, so bleibt das starke Gefühl übrig, und dieses
verbürgt Nichts für die Erkenntniss, als sich selbst, ebenso wie der
starke Glaube nur seine Stärke, nicht die Wahrheit des Geglaubten
beweist.
16.
Erscheinung und Ding an sich. - Die Philosophen pflegen sich vor das
Leben und die Erfahrung - vor Das, was sie die Welt der Erscheinung
nennen - wie vor ein Gemälde hinzustellen, das ein für alle Mal entrollt
ist und unveränderlich fest den selben Vorgang zeigt: diesen Vorgang,
meinen sie, müsse man richtig ausdeuten, um damit einen Schluss auf
das Wesen zu machen, welches das Gemälde hervorgebracht habe: also
auf das Ding an sich, das immer als der zureichende Grund der Welt
der Erscheinung angesehen zu werden pflegt. Dagegen haben strengere
Logiker, nachdem sie den Begriff des Metaphysischen scharf als den
des Unbedingten, folglich auch Unbedingenden festgestellt hatten,
jeden Zusammenhang zwischen dem Unbedingten (der metaphysischen
Welt) und der uns bekannten Welt in Abrede gestellt: so dass in der
Erscheinung eben durchaus nicht das Ding an sich erscheine, und von
jener auf dieses jeder Schluss abzulehnen sei. Von beiden Seiten ist
aber die Möglichkeit übersehen, dass jenes Gemälde - Das, was jetzt
uns Menschen Leben und Erfahrung heisst - allmählich geworden ist, ja
noch völlig im Werden ist und desshalb nicht als feste Grösse
betrachtet werden soll, von welcher aus man einen Schluss über den
Urheber (den zureichenden Grund) machen oder auch nur ablehnen
dürfte. Dadurch, dass wir seit Jahrtausenden mit moralischen,
ästhetischen, religiösen Ansprüchen, mit blinder Neigung, Leidenschaft
oder Furcht in die Welt geblickt und uns in den Unarten des
unlogischen Denkens recht ausgeschwelgt haben, ist diese Welt
allmählich so wundersam bunt, schrecklich, bedeutungstief, seelenvoll
geworden, sie hat Farbe bekommen, - aber wir sind die Coloristen
gewesen: der menschliche Intellect hat die Erscheinung erscheinen
lassen und seine irrthümlichen Grundauffassungen in die Dinge
hineingetragen. Spät, sehr spät - besinnt er sich: und jetzt scheinen ihm
die Welt der Erfahrung und das Ding an sich so ausserordentlich
verschieden und getrennt, dass er den Schluss von jener auf dieses
ablehnt - oder auf eine schauerlich geheimnissvolle Weise zum
Aufgeben unsers Intellectes, unsers persönlichen Willens auffordert:
um dadurch zum Wesenhaften zu kommen, dass man wesenhaft werde.
Wiederum haben Andere alle charakteristischen Züge unserer Welt der
Erscheinung - das heisst der aus intellectuellen Irrthümern
herausgesponnenen und uns angeerbten Vorstellung von der Welt -
zusammengelesen und anstatt den Intellect als Schuldigen anzuklagen,
das Wesen der Dinge als Ursache dieses thatsächlichen, sehr
unheimlichen Weltcharakters angeschuldigt und die Erlösung vom Sein
gepredigt. - Mit all diesen Auffassungen wird der stetige und mühsame
Process der Wissenschaft, welcher zuletzt einmal in einer
Entstehungsgeschichte des Denkens seinen höchsten Triumph feiert, in
entscheidender Weise fertig werden, dessen Resultat vielleicht auf
diesen Satz hinauslaufen dürfte: Das, was wir jetzt die Welt nennen, ist
das Resultat einer Menge von Irrthümern und Phantasien, welche in der
gesammten Entwickelung der organischen Wesen allmählich
entstanden, in einander verwachsen [sind] und uns jetzt als
aufgesammelter Schatz der ganzen Vergangenheit vererbt werden, - als
Schatz: denn der Werth unseres Menschenthums ruht darauf. Von
dieser Welt der Vorstellung vermag uns die strenge Wissenschaft
thatsächlich nur in geringem Maasse zu lösen - wie es auch gar nicht zu
wünschen ist -, insofern sie die Gewalt uralter Gewohnheiten der
Empfindung nicht wesentlich zu brechen vermag: aber sie kann die
Geschichte der Entstehung jener Welt als Vorstellung ganz allmählich
und schrittweise aufhellen - und uns wenigstens für Augenblicke über
den ganzen Vorgang hinausheben. Vielleicht erkennen wir dann, dass
das Ding an sich eines homerischen Gelächters werth ist: dass es so viel,
ja Alles schien und eigentlich leer, nämlich bedeutungsleer ist.
17.
Metaphysische Erklärungen. - Der junge Mensch schätzt
metaphysische Erklärungen, weil sie ihm in
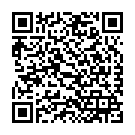
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



