war. Nur verändert die neue Praxis des Marktes die Dauer von
Marktzyklen und die Geschwindigkeit geschäftlicher Transaktionen.
Das Feilschen auf einem Basar erfordert Zeit, digitale Transaktionen
mit Hilfe von entsprechenden Programmen sind abgeschlossen, bevor
irgend jemand ihre Folgen kalkulieren kann.
Regulierungsmechanismen können die Dynamik solcher
Vermittlungsabläufe beeinflussen.
Die Sprache des Marktes
Zeichen vermitteln zwischen dem auf dem Markt repräsentierten
Gegenstand und dem Interpretant bzw. dem
Interpretationsvorgang--den Menschen also, die sich im
Interpretationsprozeß, Bedürfniserfüllung eingeschlossen, konstituieren.
Jeder Markt, gleich welchen Typus, ist ein Vermittlungsraum. Die
Unterschiede zwischen den verschiedenen Markttypen (Tauschhandel,
Wochenmärkte und Lebensmittelmessen, stark regulierte Märkte,
sogenannte freie Märkte, Untergrundmärkte) liegen nicht so sehr im
Produkt oder im Produktionsprozeß, sondern im jeweiligen
Vermittlungstypus. Dabei spielt die jeweilige dynamische Struktur des
Marktes eine besondere Rolle.
Gegenstände (Sachen, Geld, Gedanken, Abläufe), die Sprache, in der
der Gegenstand ausgedrückt wird, und die zum Abschluß oder
Mißerfolg führende Interpretation sind die drei strukturalen Invariablen,
die jedem sozioökonomischen Umfeld zu eigen sind. Im sogenannten
freien Markt (der mehr ein abstrakter Begriff als eine Wirklichkeit ist)
und in strengen Formen der Planwirtschaft sind die Beziehungen
zwischen den drei Elementen variabel, nicht aber die Elemente selbst.
In einem konkreten Zusammenhang kann der Interpretationsprozeß
nachhaltig durch die Assoziationen zwischen einem Produkt und seinen
Darstellungsformen beeinflußt werden.
Zahlreiche Dokumente der Sprachgeschichte zeugen von den
Handelsbeziehungen des Menschen, von den einfachen bis zu den sehr
komplexen Formen. Besitzverhältnisse und Besitzmerkmale werden
ebenso versprachlicht wie die Veränderungen von Wechselkursen und
des sich durch die Marktabläufe stets erweiternden Lebenshorizonts.
Aus diesem Zusammenhang sind die ersten schriftlichen Dokumente
überliefert; sie unterstützen unsere These, daß die für eine begrenzte
Skala des Werteaustausches charakteristischen Marktabläufe die Wiege
für Notation, Schrift und Schriftkultur darstellten.
Die enorme Komplexität der Marktmaschinerie ist durch eine Dynamik
gekennzeichnet, die ab einem bestimmten Entwicklungsstadium nicht
mehr durch die Gesetze und Erwartungen der Schriftkultur in den Griff
zu bekommen war. Marktabläufe unterliegen einer Form der
Selbstorganisation, die durch viele Parameter gesteuert wird; einige
von ihnen können wir kontrollieren, andere entziehen sich unserem
direkten Einfluß. Zunehmend wird diese Dynamik von spezialisierten
Sondersprachen unterstützt, die den praktischen Kontext für neue
Typen der Transaktion liefern. Netconomy war ursprünglich ein aus net,
network und economy zusammengesetztes Modewort. In weniger als
einem Jahr setzte es sich als geläufiger Begriff für eine neue Form des
Marktes durch, der mit einer außerordentlichen Effizienz immer
größere Teile der Weltwirtschaft für sich vereinnahmte. Die Folgen
dieser Netconomy wirken sich auch jeweils vor Ort aus. Traditionelle
Distributionskanäle können sich erübrigen, Wirtschaftszyklen werden
beschleunigt und Preise gesenkt. In den virtuellen Geschäften der
Netconomy werden heute schon Computer, Autos, Software und
juristische Dienstleistungen in großem Umfang abgewickelt.
Wir wollen uns nun dem Marktprozeß als Zeichenprozeß in allen
seinen Aspekten zuwenden. Indem die Menschen Waren darbieten, so
hatten wir gesagt, bieten sie sich selber dar. Die verschiedenen
Eigenschaften des Produktes (Farbe, Geruch, Textur, Stil, Design usw.)
wie auch die Qualitäten seiner Darbietung (Werbung, Verpackung,
Ähnlichkeit zu anderen Produkten) und damit zusammenhängende
Eigenschaften (Prestige, Ideologie) gehören zu den Komponenten
dieses Vorgangs. Bisweilen ist der Gegenstand an sich--ein neues
Kleidungsstück, Werkzeug, Haus, Getränk--weniger wichtig als das
"Image", das er besitzt. Sekundäre Funktionen wie Schönheit,
Vergnügen oder Anpassung überlagern die primäre Funktion der
Bedürfnisbefriedigung. Im Zeichenprozeß des Marktes erweist sich
eine derart motivierte Sehnsucht nach einem Produkt als mindestens
ebenso wichtig wie das tatsächliche Bedürfnis. In einem großen Teil
unserer Welt ist Selbstkonstituierung nicht mehr länger eine Frage des
Überlebenstriebs, sondern eine Frage des Vergnügens. Je höher in
einem Kontext des dekadenten Überflusses die semiotische Ebene des
Marktes liegt, desto bedeutungsloser wird das Marktgesetz der
lebensnotwendigen Bedürfnisbefriedigung.
Die auf Lebenserhaltung abzielende menschliche Tätigkeit
unterscheidet sich erheblich von jenen Tätigkeiten, die zu einem
Überschuß führen und dementsprechend für den Handel auf dem Markt
zur Disposition stehen. Überschuß und Tausch, die durch die
landwirtschaftliche Tätigkeit ermöglicht wurden, hatten die Skala der
menschlichen Tätigkeiten erweitert und Zeichen, Zeichensysteme und
schließlich Sprache erforderlich gemacht. Überschüsse können
vielfältig genutzt werden. Hierfür waren Zeichen und später die
Differenzierungsformen der Sprache nötig. Rituale, Schmuck, Krieg,
Religion, Akkumulationstechniken und Mittel der Überredung sind
Beispiele für solche Ausdifferenzierungen. Alle diese Verwendungen
sind charakteristisch für Interaktionsformen zwischen Menschen, die
sich als Siedler niedergelassen haben, und sie brachten Produkte hervor,
die mehr waren als materielle Konsumgüter. Sie waren allesamt
Projektionen individueller Selbstkonstituierung.
Jedes Produkt geht aus einem Zyklus von Entwicklung, Herstellung,
Handel und dem daran geknüpften Verständnis von Nützlichkeit und
Dauerhaftigkeit hervor. Als die rudimentären Formen von Schreiben
und Lesen, später die hochentwickelten Formen der Schriftkultur am
Markt teilhatten, waren die Möglichkeiten dafür geschaffen, die über
die unmittelbaren Bedürfnisse der Lebenserhaltung hinausgehenden
Produkte so zu verwenden, daß weitere Überschüsse erzeugt werden
konnten. Der Markt der Handelsgüter, der Dienstleistungen, der
Sklaven und der Ideen wurde ergänzt durch den Markt der bezahlten
Arbeitskräfte, die sich, wie die römischen Soldaten, das Geld für ihren
Lebensunterhalt verdienten. Diese neue Kategorie Mensch setzt sich in
einen pragmatischen
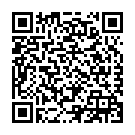
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



