und Euryalus vor Augen gehabt zu haben. So wie Virgil in
diesen die Stärke der Freundschaft geschildert hatte, wollte Tasso in
jenen die Stärke der Liebe schildern. Dort war es heldenmütiger
Diensteifer, der die Probe der Freundschaft veranlaßte: hier ist es die
Religion, welche der Liebe Gelegenheit gibt, sich in aller ihrer Kraft zu
zeigen. Aber die Religion, welche bei dem Tasso nur das Mittel ist,
wodurch er die Liebe so wirksam zeiget, ist in Cronegks Bearbeitung
das Hauptwerk geworden. Er wollte den Triumph dieser in den
Triumph jener veredeln. Gewiß, eine fromme Verbesserung--weiter
aber auch nichts, als fromm! Denn sie hat ihn verleitet, was bei dem
Tasso so simpel und natürlich, so wahr und menschlich ist, so
verwickelt und romanenhaft, so wunderbar und himmlisch zu machen,
daß nichts darüber!
Beim Tasso ist es ein Zauberer, ein Kerl, der weder Christ noch
Mahomedaner ist, sondern sich aus beiden Religionen einen eigenen
Aberglauben zusammengesponnen hat, welcher dem Aladin den Rat
gibt, das wundertätige Marienbild aus dem Tempel in die Moschee zu
bringen. Warum machte Cronegk aus diesem Zauberer einen
mahomedanischen Priester? Wenn dieser Priester in seiner Religion
nicht ebenso unwissend war, als es der Dichter zu sein scheinet, so
konnte er einen solchen Rat unmöglich geben. Sie duldet durchaus
keine Bilder in ihren Moscheen. Cronegk verrät sich in mehrern
Stücken, daß ihm eine sehr unrichtige Vorstellung von dem
mahomedanischen Glauben beigewohnet. Der gröbste Fehler aber ist,
daß er eine Religion überall des Polytheismus schuldig macht, die fast
mehr als jede andere auf die Einheit Gottes dringet. Die Moschee heißt
ihm "ein Sitz der falschen Götter", und den Priester selbst läßt er
ausrufen:
"So wollt ihr euch noch nicht mit Rach' und Strafe rüsten, Ihr Götter?
Blitzt, vertilgt das freche Volk der Christen!"
Der sorgsame Schauspieler hat in seiner Tracht das Kostüm, vom
Scheitel bis zur Zehe, genau zu beobachten gesucht; und er muß solche
Ungereimtheiten sagen!
Beim Tasso kömmt das Marienbild aus der Moschee weg, ohne daß
man eigentlich weiß, ob es von Menschenhänden entwendet worden,
oder ob eine höhere Macht dabei im Spiele gewesen. Cronegk macht
den Olint zum Täter. Zwar verwandelt er das Marienbild in "ein Bild
des Herrn am Kreuz"; aber Bild ist Bild, und dieser armselige
Aberglaube gibt dem Olint eine sehr verächtliche Seite. Man kann ihm
unmöglich wieder gut werden, daß er es wagen können, durch eine so
kleine Tat sein Volk an den Rand des Verderbens zu stellen. Wenn er
sich hernach freiwillig dazu bekennet: so ist es nichts mehr als
Schuldigkeit, und keine Großmut. Beim Tasso läßt ihn bloß die Liebe
diesen Schritt tun; er will Sophronien retten, oder mit ihr sterben; mit
ihr sterben, bloß um mit ihr zu sterben; kann er mit ihr nicht ein Bette
besteigen, so sei es ein Scheiterhaufen; an ihrer Seite, an den nämlichen
Pfahl gebunden, bestimmt, von dem nämlichen Feuer verzehret zu
werden, empfindet er bloß das Glück einer so süßen Nachbarschaft,
denket an nichts, was er jenseit dem Grabe zu hoffen habe, und
wünschet nichts, als daß diese Nachbarschaft noch enger und vertrauter
sein möge, daß er Brust gegen Brust drücken und auf ihren Lippen
seinen Geist verhauchen dürfe.
Dieser vortreffliche Kontrast zwischen einer lieben, ruhigen, ganz
geistigen Schwärmerin und einem hitzigen, begierigen Jünglinge ist
beim Cronegk völlig verloren. Sie sind beide von der kältesten
Einförmigkeit; beide haben nichts als das Märtertum im Kopfe; und
nicht genug, daß er, daß sie für die Religion sterben wollen; auch
Evander wollte, auch Serena hätte nicht übel Lust dazu.
Ich will hier eine doppelte Anmerkung machen, welche, wohl behalten,
einen angehenden tragischen Dichter vor großen Fehltritten bewahren
kann. Die eine betrifft das Trauerspiel überhaupt. Wenn heldenmütige
Gesinnungen Bewunderung erregen sollen: so muß der Dichter nicht zu
verschwenderisch damit umgehen; denn was man öfters, was man an
mehrern sieht, höret man auf zu bewundern. Hierwider hatte sich
Cronegk schon in seinem "Kodrus" sehr versündiget. Die Liebe des
Vaterlandes, bis zum freiwilligen Tode für dasselbe, hätte den Kodrus
allein auszeichnen sollen: er hätte als ein einzelnes Wesen einer ganz
besondern Art dastehen müssen, um den Eindruck zu machen, welchen
der Dichter mit ihm im Sinne hatte. Aber Elesinde und Philaide, und
Medon, und wer nicht? sind alle gleich bereit, ihr Leben dem
Vaterlande aufzuopfern; unsere Bewunderung wird geteilt, und Kodrus
verlieret sich unter der Menge. So auch hier. Was in "Olint und
Sophronia" Christ ist, das alles hält gemartert werden und sterben für
ein Glas Wasser trinken. Wir hören diese frommen Bravaden so oft, aus
so verschiedenem Munde, daß sie alle Wirkung verlieren.
Die zweite Anmerkung betrifft das christliche Trauerspiel insbesondere.
Die Helden desselben sind mehrenteils Märtyrer. Nun leben wir zu
einer Zeit, in welcher die Stimme der gesunden Vernunft zu laut
erschallet, als daß jeder Rasender, der sich mutwillig, ohne alle Not,
mit Verachtung aller seiner bürgerlichen Obliegenheiten in den Tod
stürzet,
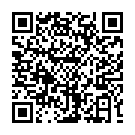
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



