Spanien ist Velazquez und Cervantes genau so völlig
unbekannt, wie dem englischen Arbeiter Shakespeare und Byron, wie
dem französischen Rabelais und Molière, wie dem holländischen
Rembrandt und Rubens sind. Das deutsche Volk hat nicht die geringste
Ahnung von Goethe und Schiller, es kennt die Bürger und Heine nicht
einmal dem Namen nach. Die kleinen Rundfragen bei den Soldaten
einzelner Regimenter: »Wer war Bismarck? -- Wer war Goethe?«
sollten doch dem vertrauensseligsten Blinden endlich die Augen öffnen.
Ganze Welten trennen den Kulturmenschen in Deutschland von seinen
Landsleuten, die er täglich auf der Strasse sieht: ein Nichts aber, eine
Wasserrinne nur, trennt ihn von dem Kulturmenschen in Amerika.
Heine fühlte das und warf es den Frankfurtern ins Gesicht, Edgar Allan
Poe sprach es noch viel klarer aus. Die meisten Künstler aber und
Gelehrten und Gebildeten aller Völker hatten ein so geringes
Verständnis dafür, dass bis auf unsere Tage Horaz' feines »Odi
profanum« falsch ausgelegt wird! Der Künstler, der für »sein Volk«
schaffen will, erstrebt etwas Unmögliches und vernachlässigt darüber
häufig etwas Erreichbares und doch Höheres: für die ganze Welt zu
schaffen. Über dem Deutschen, über dem Briten und Franzosen steht
eine höhere Nation: die Kulturnation; für sie zu schaffen, ist des
Künstlers allein würdig. Hier war Poe bodenständig, so wie es Goethe
war, wenn auch in anderm, ebenso bewusstem, aber längst nicht so
modernem Sinne.
* * *
[Abbildung: DIE WASSERGRUBE UND DAS PENDEL Zeichnung
von C. F. Tilney]
Ganz langsam schreite ich im Parke der Alhambra unter den alten
Ulmen, die Wellington pflanzte. Zu allen Seiten plätschern die raschen
Quellen, mischen ihren Singsang mit den süssen Liedern von hundert
Nachtigallen. Zwischen den hohen Türmen schreite ich in dem üppigen
Tale der Alhambra.
Wem gehört dieses Zauberschloss, dieser Träumegarten? Der
spanischen Bettelnation, die ich verachte? Dem Fremdenpöbel mit dem
roten Buche in der Hand, dem ich auf zehn Schritte schon aus dem
Wege gehe? O nein! Mir gehört es, mir und den wenigen, die diese
Schönheit in ihre Seele aufzunehmen vermögen. Deren Hauch diesen
Steinen, diesen Sträuchern Leben zu leihen vermag, deren Geist es
versteht, diese +Schönheit zur Wahrheit zu machen+. Alles um mich
herum und all das andere, was schön ist auf dieser Erde, ist ein heiliges,
unverletzliches Eigentum der Kulturnation, die über den Völkern steht.
Sie ist Herrscherin, sie ist Besitzerin: einen andern Herrn duldet die
Schönheit nicht. Das begreifen heisst die Welt ergreifen: Edgar Allan
Poe tat es als Erster.
Ich sitze auf der Steinbank, auf der Aboul-Haddjâdj einst träumte. Vor
mir springt ein Quell in die Höhe, fällt in das runde Marmorbecken. Ich
weiss wohl, warum der Sultan hier sass, allein in den Dämmerstunden:
o, es ist so süss, hier zu träumen.
War einst ein Dichter, der schrieb nichts anderes, als Gespräche mit
Toten. Mit allen sieben Weisen plauderte er und allen Königen Ninives.
Und mit ägyptischen Priestern und thessalischen Hexen, mit Athens
Sängern, mit Roms Feldherrn und mit König Artus' Tafelrunde.
Schliesslich mochte er mit keinem lebenden Menschen mehr reden: die
Toten sind so viel unterhaltsamer! -- O, man kann mit ihnen plaudern,
gewiss doch. Alle Träumer können es, und +alle die, die an Träume
glauben+, als an das einzig Wirkliche.
Bin ich nicht heute mit ihm, den ich liebe, dort oben durch die Säle
gewandert? Habe ich nicht dem Toten ein Teil von der Welten
Schönheit gezeigt, die des Lebenden Augen nie sahen? Nun steht er da
vor mir, an die Ulme gelehnt -- --
»Frage nur,« sagt er.
Er fühlt wohl, wie ich mit den Augen ihn liebkosend frage. Und er
spricht. Bald tropfen die Worte klar von den Lippen, bald plätschert
seine Stimme aus dem Springbrunn, sie singt aus den Kehlen der
Nachtigallen und rauscht mit den Blättern der alten Ulmen. So klug
sind die Toten.
»Lass du mein armes Leben,« sagt Edgar Allan Poe. »Frage Goethe
darnach, der ein Fürst war, der sechs Hengste zahlte und mit ihnen
durch die Welten jagte. Ich war ein Einsamer.«
Ich lass den Blick nicht von ihm: »Erzähle! Denen, die dich lieben, und
die du liebst!«
»Das Leben vergass ich, das ich lebte,« sagte er, »o nicht erst, seit ich
tot bin, wie die Menschlein sagen. Jeden Tag vergass ich am nächsten
Tage -- -- hätte ich sonst weiter leben können? -- Mein wahres Leben
aber, mein Leben in meinen Träumen, das kennst du ja!«
-- -- Vom Boden her huscht ein leichter Nebel durch den Abend, eine
süsse Kühle fächelt meine Schläfen. Freilich: das Leben seiner Träume
kenn ich wohl, schenkte er es doch mir und der Welt. Und langsam lass
ich dies Leben in seinen Dichtungen vor mir vorübergleiten.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
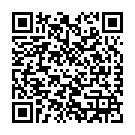
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



