wird.
Da stand unter einem Felsblock ihr kleines Haus, auf dessen
steinbeschwerten Schindeln eine große Steinbrech blühte, jene Blume,
von der die Sage der Aelpler behauptet, daß sie nur auf den Dächern
wachse, unter denen der Friede wohne. Freundlich schauten die kleinen
Fenster, vor denen Stöcke roter Geranien prangten, gegen das Dorf.
»Ja, die Wildheuerfränzi versteht sich auf Blumen.« So sprach man im
Dorf. »Blumen und Geschichten sind ihr Sonnenschein.«
Erschöpft ließ Vroni die Kraxe auf die Bank vor dem Felsblock sinken,
auch Josi stellte die seine mit einem Ausruf der Erleichterung ab.
Unter der Thüre erschien die Mutter, die Wildheuerfränzi, selbst in
ihren abgetragenen Kleidern eine hübsche Frau, von kräftigem Wuchs,
vollem, üppigem dunklem Haar, offenen Zügen und jenen großen,
blauen, vielsagenden Augen, die Vroni von ihr geerbt hatte.
»Da seid ihr ja,« sagte sie erfreut, Josi aber rief: »Mutter, eine
Neuigkeit, die Wildleutlawine kommt!«
Eine geraume Weile später sah man den Presi mit seinem Fuhrwerk
gegen das Dorf fahren.
II.
Der Gasthof zum Bären war ein Altertum des Dorfes St. Peter. Die
Ueberlieferung berichtete, das aristokratische Haus sei, als noch ein
Saumweg über die damals weniger vergletscherten Berge nach
Welschland geführt habe, eine Sust, eine Warenniederlage, gewesen,
wo die Maultiere gewechselt wurden. Man erzählte sich, die Knappen
des Bergwerkes hätten, wenn sie ihr Silber und Blei über die Berge
nach Welschland führten oder von dort mit dem Erlös zurückkamen, im
Bären hart gezecht, aus silbernen Bechern getrunken, mit silbernen
Kugeln gekegelt und manchmal sommerlang fröhliche Italienerinnen
als Spielgefährtinnen in dem Haus einquartiert.
Nur als Nachklang lebte die Erinnerung an diese üppigen Zeiten in St.
Peter fort, das Leben ging jetzt in Haus und Dorf den gemessenen
stillen Gang der einsamen Alpendörfer. Seit zwei- oder dreihundert
Jahren stand das Bergwerk still; so glänzend, wie es die Sage schilderte,
mochte das Knappenleben nie gewesen sein. Das Schmelzhaus war
eine Ruine und der alte Paßweg nach Welschland mit seinem Verkehr
war verschollen, an den Erzreichtum der Gegend erinnerten nur noch
die schönen Drusen und Gesteinsblüten, die man da und dort als
Schmuck hinter den Fenstern der Wohnungen sah.
Für den vielhundertjährigen Bestand des Bären aber sprachen seine
massive Bauart und die Jagdtrophäen, die am Dachgebälk befestigt
waren: gebleichte Steinbock- und Wolfsschädel, besonders ein
eingetrocknetes mumienhaftes Bärenhaupt, das als Wahrzeichen des
Hauses an einer Kette gegen die Thüre und die Freitreppe hinunterhing,
die mit schönem eisernem Geländer zum Eingang emporführte. Die
weißgrauen Zähne des Hauptes waren vermorscht und verwittert; die
Jagdzeichen reichten wohl bis in die Zeit der Venediger zurück, denn
so lange schon gab es im Glotterthal weder Bär noch Wolf, und seit
dem Anfang dieses Jahrhunderts sind auf den Felsen und Firnfeldern
der Krone die Steinböcke ausgestorben.
Ueber dem Fenster neben der Treppe prangte als eine neuere Zuthat am
alten Bau die Inschrift »Postbureau St. Peter« und der eidgenössische
Postschild.
Die stattlichen Wirtschaftsräume des Bären befanden sich im ersten
Stock; helles Arvengetäfel, aus dem die dunkeln Astringe wie Augen
schauten, und alte geschnitzte Wappenzier an den Decken fesselten den
Eintretenden. Der Hauptschmuck der großen Stube war ein alter
Leuchter, der ein Meerweibchen darstellte, dessen Leib in ein
Hirschgeweih auslief.
Am Eichentisch unter dem Leuchter saßen der Bärenwirt Peter
Waldisch und Hans Zuensteinen, der Garde[4].
[4] Garde (französisch %garde%, Hüter) nennt man in den Thälern, wo
»Wässerwasserfuhren« bestehen, dasjenige Gemeinderatsmitglied, das
die Aufsicht über die Wasserleitung hat.
Sie prüften das Fäßchen Eigengewächs, das jener gestern in Hospel
draußen geholt hatte.
»Wie Feuer, meiner Treu!« sagte der rauhbärtige Garde, das eine Auge
zukneifend und durch das erhobene Glas blinzelnd, in dem der
Weißwein sonngolden erglänzte -- »aber, aber, Presi,« seine Stimme
wurde plötzlich sehr ernst, »die Abmachung mit Seppi Blatter ist nichts.
Wenn der ganze übrige Gemeinderat dafür ist, so bin ich dagegen. Man
dürfte ja Fränzi, Vroni und Josi nicht mehr ins Auge sehen. Sagt mir
einmal ehrlich, wie stark hat bei seiner Unterschrift der Hospeler die
Hand geführt?«
Der Presi und Bärenwirt, der den rauhen untersetzten Garden um
Kopfeslänge überragte und neben ihm wie ein rechter Bauernaristokrat
erschien, lächelte verlegen und rückte auf dem Stuhl.
»Wollt Ihr lieber das Los entscheiden lassen?« fragte er lauernd.
Der Garde knurrte wieder, nach einer Weile fragte er aufs neue: »War
Seppi nüchtern?«
»Man macht keinen Handel, es ist ein Glas Wein zur Ermutigung dabei.
Ich war grad in guter Laune, ich ließ ein paar Flaschen Hospeler fließen,
Seppi aber war ziemlich nüchtern.«
Der Garde schüttelte bedächtig den Kopf, in den starken Furchen seines
breiten Gesichtes spiegelte sich Mißbilligung und Sorge, erst nach einer
Weile sagte er: »Das Ding ist nichts.«
Dem Presi lag augenscheinlich daran, dem Gespräch eine andere
Wendung zu geben, lachend rief er: »Zum Wohl, Garde!« Und als nun
die Gläser zusammenklingelten, fuhr er fort: »Warum ich gestern so
hellauf war, Seppi Blatter, Bälzi und dem Bäliälpler ein Glas vom
guten Hospeler schenkte,
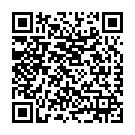
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



